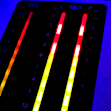Von Onkel Rosebud
So wie Suzanne Vega als „die Mutter der mp3“ gilt, sind „Die Sopranos“ die Mutter aller Serien. Das mp3-Erfinderteam um Karlheinz Brandenburg machte den ersten Praxistests für die revolutionäre Audiodatenkompression mit der A-cappella-Version von „Tom’s Diner“. Als am 12. März 2000 die erste Folge „des Paten für’s Fernsehen“ in Deutschland (ausgerechnet im ZDF) „on air“ ging, wurde TV-Serien-Geschichte geschrieben. 2007 war dann die Geschichte der Mafiafamilie Soprano aus New Jersey auserzählt, aber die rühmliche Fortsetzung startete 2013, hieß „Ray Donovan“ und dauerte bis 2020.
Meine Freundin weiß, warum große Filmschauspieler zum Fernsehen strömen. Die Rollen sind oft besser. Das Drehbuch ist definitiv besser. Statt in etwa zwei Stunden eine verkürzte Geschichte zu erzählen, können sie eine Figur in einer mehrteiligen, lebendigen, atmenden, fortlaufenden Erzählung verkörpern. Liev Schreiber spielt die Hauptrolle in der gleichnamigen Serie und ob Frau oder Mann, man fühlt sich in fast jeder Szene von ihm magnetisch angezogen. Er ist ein Problemlöser, testosterongesteuert, rau und intelligent, dabei cool, ruhig, gelassen. Ray Donovan ist ein Mann der wenigen Worte und er sieht sooo gut aus in seinen Anzügen. Andererseits ist er sowas von ohne Empathie und nahezu unterkühlt. Obwohl er immer die Kontrolle hat, kann Ray sein Berufs- und Privatleben nicht unter einen Hut bringen. Er ist tagelang verschwunden, besitzt eine Zweitwohnung in der Innenstadt und hat nichts gegen ein wenig außereheliche Aktivitäten einzuwenden.
Das Schöne an der Serie „Ray Donovan“ ist, dass es so viele großartige Aspekte miteinander verbindet. Ray war der einsame Sohn, den sein Vater Mickey (Jon Voight) nicht manipulieren konnte, und er ist soweit von zu Hause weggezogen wie möglich, um ihm zu entfliehen und seinen eigenen Weg zu gehen. Aber die Sünden des Vaters sind allgegenwärtig, und Familie ist Familie, auch wenn man sie hasst. Es geht nicht nur um den titelgebenden Protagonisten. Es gibt eine Fülle von gut geschriebenen, durchdachten Charakteren, die Pathos, Antipathie und Sympathie hervorrufen, oft gleichermaßen. Sie sind so temperamentvoll und fehleranfällig, wie jeder von uns, dabei aber so einfühlsam dargestellt, dass man versucht ist, ihnen ihre Fehler immer wieder zu verzeihen.
Bunchy (Dash Mihok) zum Beispiel ist der jüngste und genesende alkohol- und drogenabhängige Donovan. Nachdem er von einem katholischen Priester sexuell missbraucht wurde, zeigt seine Serien-Reise, wie er mit seinen Dämonen umgeht. Bunchys Unschuld (oder der Mangel daran) macht ihn zu einer Figur, mit der man mitfiebert, wenn er gut ist, aber von der man bitter enttäuscht ist, wenn er alles vermasselt. Und das tut er regelmäßig.
Die einzige Figur, für die die Sympathie nie nachlässt, ist der älteste Bruder von Ray, Terry (Eddie Marsan). Die Parkinson-Krankheit kostete ihm seine Boxkarriere, trotzdem versucht er verzweifelt, sein Boxstudio aufrechtzuerhalten, muss aber ständig seinem jüngeren Bruder oder seinem alten Herrn aus der Patsche helfen.
Es gibt keine überflüssigen charakterbezogenen Episoden oder Rückblenden, die die Aufmerksamkeit von der Handlung ablenken. Alles in „Ray Donovan“ fühlt sich straff und lebendig an. Trotzdem enden die Staffeln mit einem Gefühl, dass sich alles jeden Moment auflösen könnte. Die Party ist nach sieben Staffeln leider vorbei.
Ist es also so: „Ray Donovan“ ist die perfekte Fortsetzung der „Sopranos“? Hmm… nicht ganz. Rays Ehefrau Abby (Paula Malcomson) leidet unter den typischen Merkmalen einer TV-Ehefrau (siehe Carmella aus „Sopranos“ und Skylar aus „Breaking Bad“): Sie wird von einem abwesenden Ehemann zu einer Affäre und von ihren verwöhnten, anspruchsvollen Kindern in die Verzweiflung getrieben. Das ist im Nachhinein schade, aber war in Sachen Storytelling wohl so Usus in den 2000/2010ern. Gut, dass da heutzutage Änderung in Sicht ist.
„Tom’s Diner“ ist ein Song über ein kleines Restaurant in New York. Das Lied hat keinen Refrain. In der 5. Strophe dichtete die unglaublich tolle Künstlerin Suzanne Vega:
“I open up the paper,
There’s a story of an actor
Who had died while he was drinking
It was no one I had heard of”
Tony Soprano und Ray Donovan würden kurz zustimmend dazu nicken, um anschließend ungerührt weiter am Espresso zu nippen. Ohne Milch, aber mit drei Stück Zucker.
Onkel McNulty, Heisenberg Rosebud