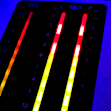Von Onkel Rosebud
Neulich stellte meine Freundin fest, dass man sich, bevor man Peter Richter (*1973) im Internet findet, sich durch diverse Gleichnamige durcharbeiten muss, die alle im Klickbaiting über ihm stehen. Da wären zum Beispiel ein Jurist (*1983), Anwalt der NPD, ein Physiker, der sich um den Supraleiter verdient gemacht hat, oder der Chefdirigent des Siegerland-Orchesters (*1930) und diverse Fußballspieler (Wismut Gera, Chemie Leipzig, Wacker Burghausen, UFC Neukirchen an der Enknach).
„Unser Peter Richter“, der Journalist und Buchautor aus Dresden, hat also auf jeden Fall kein Alleinstellungsmerkmal in Sachen Name. Und es irritiert dazu, dass er in seinem deutschen Wikipedia-Eintrag auf einen Kunstkritiker reduziert wird und sein größter Wurf, der Coming-of-Age-Roman „89/90“, nicht erwähnt wird. In dem Buch erzählt er von der Unschuld des letzten Sommers des Sozialismus im „Tal der Ahnungslosen“, seiner Geburtsstadt. In seinem autobiografischen Werk beschreibt er aus der Sicht eines Sechzehnjährigen das chaotische Ende der DDR – wunderbar selbstironisch und voller kluger Anleihen an die damalige Musikszene. Es geht um Mädchen, Alkohol, Nächte im Freibad und überhaupt jede Menge jugendlichen Blöd- und Leichtsinn, den wir alle – egal ob in Ost der West – so oder ähnlich in der Adoleszenz erlebt haben.
Für meine Freundin und mich hat Peter Richters Roman aber noch eine andere Komponente der Bedeutung. Er entwirft mit seinem Ich-Erzähler eine Gegenfigur zu den Dresdner Literaturaristokraten, Uwe Tellkamp, bzw. sein Alter-Ego Christian in dessen Roman „Der Turm“, und Ingo Schulze. Statt deren heiligem Ernst und Pathos sind wir mit Peter Richter Ende der 80er zu Konzerten in Schuppen wie „Bronx“, „Planwirtschaft“, „Scheune“ oder „Café 100“ auf der richtigen Elbseite, in der Neustadt, gegangen, um Bands wie Herbst in Peking, Big Savod, Dekadance oder Freunde der Italienischen Oper in ihrem musikalischen Coming of Age zu erleben.
„89/90“ ist keine DDR-Reprise, kein bundesdeutsches Identitätsgekrampfe. Es ist ein amüsantes Buch – vor allem für jemanden, der selbst dabei gewesen ist. Einiges darin ist auch überflüssig (weil sich Inhalte wiederholen) und überheblich. Aber die Grundthemen des Buches, das Erwachsenwerden einer Generation ohne Vorbilder in Zeiten, wo die Sorgen des Alltags noch klein waren und Zukunftsängste keine Rolle spielten, ist schon noch relevant.
Aber mehr auch nicht.
Onkel Rosebud