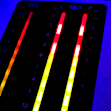Von Onkel Rosebud
Bei allem, was die Weltliteratur so hergibt, findet meine Freundin neben Kafkas Verwandlung die Geschichte „Bartleby, der Schreiber“ von Herman Melville am abgefahrensten.
Die Handlung geht so: Ein namenloser New Yorker Anwalt in den 1850ern erzählt die Geschichte seines überaus seltsamen Schreibers Bartleby. Zuerst stellt er sich selbst, seine Kanzlei, die Angestellten namens „Puter“, „Beißzange“ und „Pfeffernuß“ mit ihren Eigenheiten vor. Eines Tages erscheint ein junger Mann in der Kanzlei: Bartleby, „sauber, erbarmungswürdig, achtbar und einsam“. Anfangs kopiert dieser Tag und Nacht mit stillem Fleiß und einsiedlerischer Ausdauer. Doch dann beginnt er, die Arbeit ohne Angabe eines Grundes mit den Worten „Ich möchte lieber nicht“ zu verweigern: Bartlebys passiver Widerstand löst in der Runde Rätselraten aus. Wie kann man mit ihm umgehen? Puter meint, gutes Bier könne helfen. Alle diskutieren darüber, während sich Bartleby hinter seinem Wandschirm einrichtet. Der Erzähler versucht, von Bartleby etwas über dessen Leben zu erfahren, um seine Motivation zu verstehen. Aber Bartleby „möchte lieber nicht“ mehr seine Arbeit machen.
Eines Sonntagmorgens ist die Kanzlei verschlossen – von innen. Der Schreiber ist in die Kanzlei eingezogen. Der Erzähler will gelassen bleiben und gibt ihm eine Frist von sechs Tagen, die Kanzlei zu verlassen. Doch die Geschäftsfreunde tuscheln über seinen sonderbaren Bürobewohner. Am Ende hilft nur: Er muss mit der Kanzlei umziehen und Bartleby zurücklassen.
Ist Bartleby ihm von höheren Mächten vorbestimmt? Warum verweigert er sich sanft allen Arbeiten – und gegen Ende der Geschichte dem Leben? Herman Melvilles kleines Büchlein um den stillen Verweigerer Bartleby und seinen berühmten Satz „Ich möchte lieber nicht“ zählt zu den meistinterpretierten Werken der Weltliteratur. Laut den Gelehrten ist Bartelby Herman Melville selbst. Zwei Jahre vor Bartleby hatte er den Graniten der Weltliteratur „Moby Dick“ rausgehauen und niemand hat es interessiert. Der Ich-Erzähler, der Advocat, der nicht motivieren kann, soll Edgar Allen Poe sein.
Meine Freundin ist keine Literaturwissenschaftlerin, findet diese Prosa jedoch absolut faszinierend. Die Ereignisse werden linear in einer Zeitspanne von etwa vier Wochen auf sehr unemotionale Weise vorgetragen, bis der allmähliche Klimax der Verweigerung eintritt. Für sie beschreibt die Geschichte die Pathologie eines Melancholikers. Bartleby möchte sich gar nicht helfen lassen. Er empfindet seine Verweigerungshaltung als sein Recht, das Recht, melancholisch zu sein.
Goethe war gut. Man, der konnte reimen. Folgendes reimt sich zwar nicht, ist aber von ihm als Kommentar auf einen Bibelvers überliefert und passt prima dazu, wie Melville mit „Bartleby, der Schreiber“ Kafka und Teile seines Oevres vorweggenommen hat: „Selig sind die Friedfertigen, sagt das Gewissen. Aber das Rechtsgefühl meint: Wer das Recht auf seiner Seite fühlt, muss derb auftreten; ein höfliches Recht will gar nichts heißen.“ (aus Johann Wolfgang, Vers 5,1-12).
Für weitere Anleitungen zur Karriereverweigerung steht jederzeit zur Verfügung
Onkel Rosebud