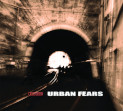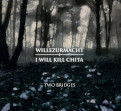Von Matthias Bosenick (09.10.2025)
Ein neuer Reigen Musik vom fantastischen Label addited/noname aus Moskau, dieses Mal mit dem Schwerpunkt IWKC alias I Will Kill Chita alias Evil Bear Boris, ganz abgesehen von solchen Band-Kombinationen wie REEBBB, DEEBBB oder Pizzdolf EB. Die Musik dieser Instrumental-Band ist so unberechenbar wie ein Überraschungsei: Man weiß nie, was man bekommt, aber es ist immer gut. Los geht es mit der 2010er Debüt-EP „Best Days“, das jüngste Album „Misha“ erhielt, wie einige weitere Veröffentlichungen, auf dieser Seite bereits an anderer Stelle seine Berücksichtigung.
IWKC – Best Days (2010)
Mit „Best Days“ setzten IWKC vor 15 Jahren ihre Debüt-EP in die Welt. Die ganz große Leinwand hatten sie vor Augen, als sie „All You Know About Me“ angingen. Episch-opulent im Midtempo rockend, baut das Quartett bald ein Keyboard ein, dessen Melodie die Welt und alle verfügbaren Emotionen umarmt. Dieses Keyboard bliebt auch für „Paris Holidays“ und „Best Days“ erhalten, alles Instrumental-Stücke, deren Grundierung im Rock verortet ist, in dem so ein synthetische Töne generierendes Tasteninstrument wie ein Fremdkörper erscheinen mag – aber nicht, wenn man es zu integrieren weiß, und das wissen IWKC. Der Rock ist hier nie hart, aber dennoch vernehmlich, und der letzte Track blickt in Richtung Post Rock, was zu der Zeit vor 15 Jahren visionär gewesen sein dürfte. In den ersten beiden Tracks baut die Band das Keyboard noch melodie- und emotionsführend ein, im dritten dominiert eine Solo-Gitarre und der Synthie generiert Flächen. Die Band selbst lässt das Schlagwort Progrock fallen, kann man abnicken. Als vertraute Kombi von Rockmusik mit Keyboard fällt einem ansonsten ein, wie Faith No More damit bis zur „The Real Thing“ umgingen, als selbstverständliches Element, das man gar nicht erst in Frage stellt und vielmehr als integralen Bestandteil akzeptiert.
Die Band bestand damals aus: Gitarrist und Keyboarder Nick Samarin, Schlagzeuger und Elektroniker Nik Samarin (das kann verwirren, er heißt eigentlich Nikita), Keyboarder und Elektroniker Andrei Silin sowie Bassist Alexander Ivanov.
IWKC – Not A Dream (2011)
Als zweites folgte abermals eine EP, besser: eine Single. Auf „Not A Dream“ baut die Band die Kombi aus Rockmusik und Keyboard zu etwas Hymnisch-Melancholisch-Wavigem aus und versieht es mit verhuschtem weiblichem Gesang. Manche Gitarren erinnern an den britischen Postpunk-Waverock der Achtziger, The Alarm oder zeitgenössische U2. Die Band steigert sich richtig in das Stück hinein und empfiehlt es als emotionalen Dancefloor-Kracher im Gruft-Club. Das Titellied Lügen straft die B-Seite „Spring Will Come“, so verträumt und traumhaft, wie es als Ambient-Poprock beginnt und die Berliner Schule der Siebziger mit dem Wave der Achtziger kombiniert – durchaus melodiös, aber ohne Beats.
IWKC – Urban Fears (2012)
Mit „Urban Fears“ legte das Quartett das erste Album vor, mit nur sechs Stücken, die dafür umso länger sind, sowie zwei Gastmusizierenden: Artem Litvakovsky spielt das Cello, Anastasiya Narochnaya die Geige. Diese beiden treten hier, wie bereits zuvor sowie auch hier das Keyboard, nicht lediglich als schlichte Kleistermasse auf, sondern auch als Quasi-Ersatz für eine Singstimme, als Solo-Instrument oder im harmonischen Zusammenspiel mit den Synthies. Bewegt sich die musikalische Grundausrichtung hier deutlicher im Prog- und Post-Rock, bringen die Streichinstrumente zusätzlich etwas Folkiges in die Musik ein. Oberflächliche Fröhlichkeit findet damit indes gottlob keinen Einzug, das Melancholische liegt der Band einfach inne.
Spaß würde auch gar nicht zum Konzept passen: Auch Instrumental behandelt das Album ein Thema, „Urban Fears“ heißt es nicht ohne Hintersinn. Die Band nahm es damals in aufgelassenen Industrieruinen am Rande von Moskau auf und verarbeitete die Eindrücke von Großstädtischkeit, Verlorenheit und Orientierungslosigkeit am gewerblichen Rande einer solchen Metropole. Titel wie „Lost“, „Fear Of Suburbs“ oder „Endless Odyssey“ verdeutlichen dies – doch kurioserweise entstand hier keine erwartbare Industrial-Musik. Die Band bleibt der Ausrichtung der beiden Vorab-EPs treu, fährt indes sogar noch das raumgreifend Hymnische zurück. So dunkel, dass man tatsächlich Angst bekäme, ist die Musik andererseits auch wieder nicht, es schimmert trotz aller Wehmut immer etwas Hoffnung mit. „Those Who See The Light“ treten der „Urban Fear“ möglicherweise besser gewappnet entgegen. Der Schluss gestaltet sich beinahe cineastisch – trotz des bedrückenden Themas verlässt man das Album nicht bedrückt.
I Will Kill Chita – Before We Disappear (2013)
Hatte das Debüt noch gerade mal zwei Gäste, trumpft der Nachfolger mit einem Ensemble in Orchestergröße auf. Das kommt auf „Before We Disappear“ zwar auch hörbar zum Einsatz, aber nicht als Kitsch: Hier spielt durchaus eine Rockband, die sich indes mit klassisch instrumentierten Musizierenden zusammentut und mit ihnen gemeinsam musiziert, sie also nicht als Tapete missbraucht. Gitarren und Streicher spielen unterschiedliche, sich aber ergänzende Passagen, zum Beispiel. IWKC – hier ausnahmsweise mal als I Will Kill Chita – stopfen ihre Musik nicht voll, sie wissen ihr Potential dosiert und damit wesentlich effektvoller einzusetzen.
Mit „USSR“ eröffnet die Band das Album auf eine Weise, dass man sich beim Hören in die UdSSR versetzt fühlt. Etwas Schwermut, ein leichter Hauch von Übertreibung, aber so schön, dass man sich dem gern hingibt. „Hard Times“ mit elf Minuten ist dann derart komplex, dass man es für mehrere Stücke halten könnte, mit Western-Twang, Post-Rock-Atmosphären und losbrechendem Rock mit Streichern inmitten dieses epischen Werkes. Ein Gothic-Bass kommt in „Streets Going Under Water (Part I)“ dazu. Der Zwanzigminüter „Young Heroes“ erinnert anfänglich rhythmisch an die Rock-Stampfer von Neil Young, im Zusammenspiel von Synthies und Rockinstrumenten hingegen umso weniger. Auch dieses Stück könnte in mehrere kleinere Tracks unterteilt werden, so viel Gegensätzliches passiert hier. Ein Bisschen „Vagabonds“ von New Nodel Army lässt sich in dieser alternativen Rockmusik mit Streichern durchaus mal entdecken, etwas Disco in „We Had Only One Day“, leicht orientalische sowie stark klassische Anflüge in „Memories“. Der Abschluss „Streets Going Under Water (Part II)“ kehrt zur Düsternis zurück und erfolgt rein mit einer halligen Gitarre und leichten Drones im leeren Raum.
In vielen Momenten fällt auf, dass die Band ihre ansonsten übliche Melancholie mit kraftvolleren Rockismen zur Seite drängen und dann sogar Euphorie wecken kann. Und überhaupt mit wahnsinnigen Einfällen, das Album steckt voller Ideen – die Band macht was Gutes draus, dass sie hier einen Stapel Freunde ins Studio holt. Neben den beiden Gästen vom Debüt sind dies: Ksenia Pluzhnikova und Karthick Iyer mit Violinen und Violas, Denis Smirnov am Horn, Konstantin Podgorbunsky an Tuba und Posaune, Egor Gerasimchuk an der Trompete sowie Boris Medved an Keyboards.
IWKC – Oceans (2014)
Mit „Oceans“ beschränken sich IWKC einmal mehr auf eine Zwei-Track-Single. Das Titelstück bedient sich im gniedelfreudigen Artrock irgendwo bei Mark Knopfler oder Mike Oldfield, die Musik dazu ist angefrickelter Uptempo-Poprock – mit Streichinstrument. Denn obschon IWKC hier als Quartett auftreten, räumte Alexander Ivanov seinen Platz für den bereits bekannten Cellisten Artem Litvakovskiy. Den Blick in die Rockpop-Achtziger behält die B-Seite „Waves“ bei und unterstreicht diesen Anschein mit spacigen Synthies, bevor die Band das Stück mit Anflügen von Waverock auflockert. Einmal mehr begeistert hier die Kombination von Melancholie und Aufmunterung, dargeboten mit einer großartigen musikalischen Finesse.
Wille Zur Macht & I Will Kill Chita – Two Bridges (2017)
Eine weitere IWKC-Zusammenarbeit, die es auf immerhin drei Veröffentlichungen sowie einen Gast-Auftritt brachte, ist die mit Wille Zur Macht, auch Willezurmacht oder WZM. Mit den aus Zweibrücken kommenden Nietzsche-Jüngern verlegen IWKC den Schwerpunkt auf den verlangsamten Post Rock, erweitern das Spektrum aber um Drones und Soundscapes. Dafür sorgen eben Nicolas Perrault und Dominik Klein. Ersterer trägt mit seiner Black-Metal-Erfahrung sicherlich einen großen Anteil daran, dass die Musik hier sogar noch schwermütiger ist, als man es von IWKC ohnehin kennt.
Sind „Siebente Einsamkeit“ und „Morgenröte“ noch dronedominiert, fährt das Ensemble danach die Radikalität herunter und verortet „Als ich einst Abschied nahm“ eher im minimalistischen Black Gaze, mit unverzerrten Gitarren, die dunkel nach Einsamkeit klingen. „Ein Abgrund ohne Schranken“ gerät etwas freundlicher, und angesichts des in höheren Tonlagen gespielten sphärischen Keyboards und der leichten Beschleunigung in „Warm atmet der Fels“ wundert man sich, wie vielfältig eine solche Zusammenarbeit ausfallen kann. Der Track groovt aber auch! Ganz anders „Die Wüste wächst“: 18 Minuten lang lassen die sechs Musiker einen gemächlich mäandernden, düsteren Drone in der Gegend herumstehen.
Als Beitragende listet die Info hier lediglich Pseudonyme auf: Chita, Dron, Tyoma, Koljunia, Dominik und Niki. Einige lassen sich entschlüsseln, immerhin stimmt die Zahl der Namen mit der der jeweiligen Bandbesetzung überein. Zu den anderen gemeinsamen Veröffentlichungen wiederum sind WZM und IWKC etwas eindeutiger – und musikalisch auch wieder anders: Die „Evil Cosmonaut“-EP beispielsweise ist heavy, dieses Album ist es nicht, ohne jedoch an Gewicht einzubüßen. Zudem ist die Musik trotz dieser Schwere unerwartet warm, man fühlt sich in ihr durchaus geborgen. Was hier als einziges wundert, ist, dass das Album nicht wie die Tracks einen deutschsprachigen Titel trägt.
IWKC & WZM – Logbook Of The Ark (2019)
Zwischen der EP und dem Album gab es aber noch den Live-Mitschnitt „Logbook Of The Ark“, aufgenommen 2015 in Zweibrücken. Hört man sich den auf die zwei Stücke „Flood“ (26 Minuten) und „The Only Passenger“ (34 Minuten) verteilten Auftritt an, wünscht man sich sofort, dabei gewesen zu sein: Obschon da sechs Leute auf der Bühne standen, besteht der Auftakt lediglich aus ganz leisen unendlichen Ambient-Tönen, man will von Drones da noch gar nicht sprechen, erst nach ewigen Minuten versetzt mit anderen Tonfolgen, alles körperlos schwebend, leise, kurz davor, überhaupt gar nicht zu existieren. Nach über zwölf Minuten erst meint man einen Bass zu hören, den man von Angelo Badalamenti kennen könnte und der dezidiert dunkle Punkte in die dunkle Leere setzt. Nach einer Viertelstunde intensiviert sich das Grunddröhnen etwas, ein weiteres gesellt sich hinzu, ebenso vereinzelte hallige Töne. Erst nach 22 Minuten kann man kurzzeitig ein vereinzeltes Anklicken der Hihats erahnen.
Wenn das die Flut ist, die den Einsatz einer Arche erfordert, dann steigt sie nur gemächlich, unscheinbar, ohne die Bedrohung, die sie ja eigentlich darstellt, schließlich geht in ihr die gesamte Menschheit zugrunde. Damit ist „Flood“ ein perfider Einstieg in diese Massenvernichtung, weil er die Hörerschaft in Sicherheit wiegt. Wogt, ist man zu sagen geneigt.
Die Katastrophe deutet sich indes im Titel des zweiten Tracks an, schließlich bleibt demzufolge ja nur ein Passagier übrig. So richtig schlägt sich das in der Musik jedoch nicht nieder, die setzt schlichtweg am ersten Track an und führt die anhaltenden Soundscapes fort. Es dringen indes über die Spielzeit mehr und mehr Elemente in den Reigen ein, nach sieben Minuten meint man Streich- oder Blasinstrumente zu hören, und ja, es bestätigt sich, das muss eine Trompete sein, die da die mittlerweile bedrohlich anschwellenden Drones durchstößt. Auf der E-Gitarre liegt ein Feedback; zuvor war dieses Instrument als Sounderzeuger gar nicht zu identifizieren, lediglich die eigene Erfahrung mit Krautrock-Bands wie Neu! oder La Düsseldorf sowie den Berlin-Alben von David Bowie ließ dies vermuten. Dann, nach zwölf Minuten: eine Oboe? Mit einer beinahe hoffnungsvollen Melodie inmitten des sich andeutenden Gebrülls, Geächzes, Gestöhnes, das dann doch nicht ausbricht, sondern beständig als Bedrohung aufrecht bleibt. Ein Rauschen tritt ein, alles wird leicht kakophonischer, dräuend, bedrohlich, dröhnend, und doch unterschwellig sakral, wie der Chorgesang von Leviathanen in einer Kathedrale. Berauschend!
Die Musik generiert zwar ein Kopfkino, das sich auch unabhängig vom biblischen Katastrophenthema von allein in Bewegung setzt, und doch hätte man die Musiker gern dabei beobachtet, wie sie miteinander live eine solche Musik erzeugen. Bei der es sich nach klassischer Definition für viele gar nicht um Musik handeln mag, vielmehr um tongewordene Verweigerung. Und dann auch noch so schöne!
Von IWKC gibt es noch viel, viel mehr Musik, über einiges ist hier auf KrautNick bereits zu lesen. Erhältlich ist alles auf Bandcamp.