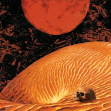Von Matthias Bosenick (13.08.2025)
Neues Futter von den Freunden aus Moskau: Lärm-Core von Шаййм, Jazz-Core von Brom und Brom mit Toshinori Kondō, Doom von Zatvor, Instrumental-Rock von Резина, instrumentalen Space-Rock von Disen Gage sowie Rock und Drones von Nick Samarin.
Шаййм – Нет никого (2025)
Was ist mit Шаййм (Shajjm) passiert? Die Band aus Moskau veränderte für ihr drittes Album „Нет никого“ („Es gibt niemanden“) die Grundvoraussetzungen: Die Flöte wich einem Saxophon, der Kontrabass räumte für einen E-Bass das Feld. Ja, damit generiert die Band mehr Härte als zuvor, doch darf man sich hier jetzt keinen Metal vorstellen: Aggressivität dringt aus den Songs, Rauheit, weniger Verzweiflung als Tatendrang, der dringliche Wunsch, etwas zu bewegen, etwas zu verändern, etwas zu überwinden, und sei es wenigstens damit, Missstände überhaupt zu benennen, besser: zu beschreien, besingen, belärmen.
Lärm ist hier durchaus ein Mittel der Wahl, koordinierter Lärm, der sich aus der intensiven Verwendung der Rockinstrumente speist und diese mit dem von sich aus schon variabel einsetzbaren Saxophon verstärkt. Angewandt in stürmischer Ausprägung, stülpen Шаййм den Hörenden ihren Unmut über und nehmen sie für sich ein, und man folgt ihnen bereitwillig. Denn Lärm allein macht nicht glücklich, und so besinnen sich Шаййм auf das, womit sie starteten, und bringen herrliche Melodien, kontemplative Sequenzen, Klarheit, Schönheit unter. Und Rap, manche Textpassagen äußert die Band in einer unerwarteten Darreichungsform. Dieser Lärm nun hat in den Extremsituationen etwas von sehr hartem Indierock, man könnte bald den guten, alten Hardcore heranziehen, versetzt mit Jazz, frickelig und druckvoll gleichermaßen, und er funktioniert besonders deshalb so gut, weil er nicht allein dasteht, sondern sich den Raum mit den klaren Anteilen teilen muss. Eins nach dem anderen, wie ein Wellenverlauf in einem Fluss.
Шаййм sind: Gitarrist und Sänger Никита Чернат (Nikita Chernat), Saxophonist Иван Занегин (Ivan Zanegin), Bassist Роман Комлев (Roman Komlev) und Schlagzeuger Андрей Пищита (Andrej Pishchita).
Brom – Чёрная голова (2025)
Noch mehr Saxophon und alternative Musikrichtungen mit –core am Ende gibt’s von Brom (Бром) aus Moskau, indes komplett anders ausgerichtet: Auf dem neuen Album „Чёрная голова“ („Schwarzer Kopf“) überwiegt der Jazz, also das Saxophon und die Frickelarbeit. Das, was dereinst der Punk als Quelle darstellte, biegt das Quartett hier zu einer überwiegend vergleichsweise klaren Musik um, die die Härte und Rauheit abstreift und vielmehr die komplexen Kompositionen darstellend begleitet. Aber wie: Die Komplexität beherrschen die Musiker nach wie vor, und dadurch, dass sie auf radikale Verzerrung verzichten, erscheint sie umso offenkundiger und staunenswerter.
Dennoch ist das Saxophon hier das dominante Utensil, es übernimmt, was anderswo möglicherweise der Leadgesang gewesen wäre, und erweitert diese Position um frickelige Melodieführung – und um das, was man aus dem freien Jazz kennt, die experimentelle Nutzung des Instruments, die bis in das atonale Tröten hineinreicht. Wie geil hier dann Bass und Schlagzeug mit dem Saxophon zusammenspielen, gelegentlich ergänzt um fies zirpende Synthies! Und doch: In „Джазовая микродозировка“ („Jazz-Mikrodosierung“, haha!) bekommt der Bass nochmal den Hardcore-Fuzz, auch an weiterer Stelle dürfen die anderen Musiker ihrem ursprünglichen Gewerk nachgehen, inklusive diverser atonaler Noise-Attacken. Und, echt: Ist das da eine Flöte in „Бучарда“ („Bouchard“)?
Die Brom von heute sind nicht mehr dieselben wir zuletzt, es gab einige Wechsel in der Besetzung. Geblieben sind Bassist und Effektbeauftragter Dmitry Lapshin sowie der für Electronics zuständige Feliks Mirenskiy. Neu sind Schlagzeuger Bogdan Ivlev, der für Yaroslav Kurilo einsprang, und Tenor-Saxophonist Ivan Bursov, der Anton Ponomarev ablöste. Seit 2020 ist offenbar einiges passiert, die vorletzte Veröffentlichung „The Sea Is Rough“ hat tatsächlich bereits fünf Jahre auf dem Buckel.
Brom & Toshinori Kondō – The Sea Is Rough (2020)
Damals bestanden Brom indes nur aus drei Leuten, die sich als Bonus den Freejazz-Trompeter Toshinori Kondō dazuholten. Ihm zur Seite standen da Saxophonist Anton Ponomarev, Bassist Dmitry Lapshin und Schlagzeuger Yaroslav Kurilo, als sie gemeinsam das zweigeteilte Stück „The Sea Is Rough“ einspielten. Und wahrlich, die See ist rauh: Kaum 13 Minuten lang bildet das Quartett das Auf und Ab des wilden Meeres ab und fusioniert dafür Noiserock mit Freejazz. Das kommt schon sehr geil, wie sich hier die beiden Blasinstrumente gegenseitig aufschaukeln und den Lärm generieren, den hier keine Gitarre unterstreichen muss, weil die einfach ausreichend Kraft haben, um mit Bass und Schlagzeug als zweckentfremdete Rock’n’Roll-Basis mitzuhalten. Einziger Nachteil dieser EP: Sie ist eigentlich viel zu kurz.
Zatvor – Ключ земли (2018)
Was ein Mammutbrocken: „Ключ земли“ („Der Schlüssel zur Erde“) war 2018 das Debüt von Zatvor aus Kursk, und die Band reichte diesen Schlüssel als einen einzelnen Track dar, der satte 49 Minuten dauert. Der Band gelingt es, auch ohne progressive Verschachtelungen oder hasenartige Sprünge über die gesamte Spielzeit hinweg die Spannung aufrecht zu halten, indem sie den Geröllfluss behutsam variiert und dessen Sprengkraft zusehends mindert, bis hinein ins Nichts.
Denn das Stück startet als Doom-Metal, als harsche malmende Lawine, die mit dem Sludge nahen Drones und schleppendem Tempo die Dunkelheit über die Hörerschaft hereinbrechen lässt. Auch an diesem Lärm ist ein Saxophon beteiligt, doch drängt dies den Sound deutlich weniger in die Jazz-Richtung. Sobald dieser Geröllfluss indes seine Energie ausrollt, verändert sich auch der Sound: Das Stück entwickelt sich in etwas, das man beinahe als Folklore bezeichnen kann. Das Saxophon weicht einer Flöte, und weich wird auch die Musik. Bis alles wahrhaftig an Ambient ausläuft, in Soundscapes, in Leere, ins Nichts. Was für ein Auftakt!
Wenn man dann noch berücksichtig, dass an diesem Naturereignis lediglich drei Leute beteiligt sind: Denis Kolesnikov mit Gitarren und Noises, Anton Eremin mit Schlagzeug, Percussion und weiteren Noises sowie Sergei Letov mit Saxophon und Flöte. Kein Bass also, und das, obwohl das Stück sehr nach tiefster Erde klingt. Zumindest den Schlüssel dafür haben die drei Musiker.
Zatvor – Охотник (2024)
Die nächste Veröffentlichung von Zatvor war dann tatsächlich erst 2024 die EP „Охотник“ („Die Jägerin“), ebenfalls nur aus einem Track bestehend, der allerdings lediglich eine Viertelstunde lang ist. Nicht der einzige Unterschied: Die Band ist inzwischen zu viert, verwendet einen Bass und lässt Gesang erklingen. Katya Sumina erzählt von der Titelheldin in einer Art, die man mit der von Siouxsie Sioux vergleichen könnte; außerdem spielt sie Keyboards. Jenen Bass übernimmt der vorherige Schlagzeuger Anton Eremin, dessen Posten nun Kirill Kiryukhin einnimmt. Denis Kolesnikov bleibt an Gitarre und Noises.
Ebenfalls bleibt die Grundierung im Doom, nur dass eben Gesang an die Stelle der Blasinstrumente tritt. Mit einer langsamen Schwere rollt und rumpelt das Stück, wie man es vom Doom kennt, nur dass der Gothic-nahe Gesang hier etwas Schamanisches hinzufügt, eine Art Mantra, und zudem den rauhen Sound der Instrumente mit Klarheit konterkariert. Dieser fuzzy Doom ist wunderschön, auch wenn er instrumental ausläuft – mit Geisterstimme zum Schluss.
Резина – Минус два (2024)
„Минус два“ („Minus zwei“) ist – der Titel verrät’s – nach dem grandiosen Album „1619“ die zweite EP von Rezina, die ohne Gesang auskommen muss. Die Moskauer Indie-Rocker liefern hier zwei sehr gegensätzliche Tracks: „Марево“ („Dunst“) ist ein schleppender Kriecher, der mit teils klar gespielten Postrock-Anleihen und Slidegitarre einem trotzdem angerauhten Doom naherückt. Die Band mostet sich hier in Trance, man möchte unbedingt mit in diesen Zustand abtauchen.
Doch dann kommt „Зарево“ („Glühen“) und der Dunst verweht aus dem Stand: Das Tempo zieht an, der Track ist ein frickeliger, nervöser Indierock mit ungeradem Rhythmus und fortgesetzter Slidegitarre. Auch hier steigern Rezina die Intensität, beinahe nebenbei spielen sie sich glatt in den nächsten Rausch hinein, nur das diesem weit mehr Energie innewohnt. Hier passt auch gar keine Stimme, die Band belegt, dass sie ursprünglich gar nicht als Gesangsbegleitung ausgelegt war. Beide Inkarnationen haben indes ihre Berechtigung – „1619“ belegt dies nachhaltig.
Rezina sind hier die beiden Gitarristen Ilya Zinin und Andrey Klimov, Bassist Oleg Lisitsin und Schlagzeuger Dmitry Drozdov. „Minus eins“ erschien 2023.
Disen Gage – Bar In The Outskirts Of The Universe (2024)
Wie gelangen wir in den Kosmos? Mit dem nötigen Treibstoff! „Bar In The Outskirts Of The Universe“, der Livemitschnitt von Disen Gage aus Moskau, hat jenen: Gleich der Opener „Solaris“ klingt bekifft, ein psychedelisch spaciger Instrumental-Rock mit Offbeat. Hier kommt alles zusammen, was gutes Weed so hervorbringt. Außerdem belegt die Band, dass sie auf ihren Studioalben nicht ausschließlich improvisiert, denn einige vertraute Tracks bringt sie auch auf diesem Auftritt zu Gehör. Die Rückgriffe auf die Studioarbeiten reichen vom vorletzten Album „The Big Adventure“ aus dem Jahr 2019, also zwei Jahre nach diesem Mitschnitt, bis zum Debüt „The Screw-Loose Entertainment“ aus dem Jahr 2004, versetzt mit Stücken, die hier offenbar exklusiv sind.
Insgesamt geht das Quartett hier behutsam vor, die Musik bleibt auf weiten Strecken zurückhaltend, chillig, spacig, aber eben nicht ausschließlich. Regelmäßig schleicht sich ein tanzbarer, mindestens kopfnickbarer Groove ein, und wenn es die Band komplett überkommt, verfällt das verschachtelt-progressive Gniedeln auch in einen rauhen Rock. Aber das geschieht selten, die Grundlage ist entspannt. Ein unerwarteter Höhepunkt ist der „Selfish Tango“, dem tatsächlich dieser Tanzrhythmus zugrundeliegt und der zwischendurch sogar zu einem Discobeat wird.
An diesem Auftritt im April 2017 in Moskau beteiligt waren die beiden Gitarristen Konstantin Mochalov und Sergei Bagin, Bassist Nikolai Syrtsev und Schlagzeuger Eugeny Kudryashov. Von wem die Synthie-Sounds stammen, ist nicht überliefert. Das wird irgendein Kosmonaut gewesen sein, der Disen Gage bei der Reise ins All über den Weg schwebte. Bis zur Landung auf dem harten Boden der Realität, denn der Abschluss klingt so, wie man sich im Westen wohl russische Folklore vorstellt – ein Punk-Kasatschok mit Operngesang.
Nick Samarin – Ozarenie (2015)
Eine merkwürdige Art der Erleuchtung, die Nick Samarin, Mitglied der Band IWKC, also I Will Kill Chita, also Evil Bear Boris, hier auf seinem Solo-Album in Musik umsetzt. „Ozarenie“, also „Озарение“, bedeutet nämliches, und wer nun erwartet, dass sich der Multiinstrumentalist aus Moskau mit dem strahlenden Erkenntnisgewinn auf eine Ambient-Art auseinandersetzt, wird geschockt. Die Mucke hier ist sperrig, komplex, schräg, polyrhythmisch, kakophonisch, atonal – und lässt das Thema Erleuchtung in einem ganz anderen Licht erscheinen. Als Instrumentarium steht ihm offenbar ein komplettes Arsenal zur Verfügung; repetitives Klavier, E-Gitarre, gern schräg gespielt, Schlagzeug, Bass, Synthies, weiß der Geier, was noch.
Entsprechend divers sind auch die sieben Tracks. Die ersten drei bilden eine zusammengehörige Einheit, aus „Черви“ („Würmer“), „Глаза“ („Augen“) und „Мозги“ („Gehirne“), alle drei irgendwo zwischen Jazz-Fusion-Rock und Pandämonium. Ab dem vierten Stück folgt der nächste Dreiklang: „Ожидание“ („Erwartung“), „Отрицание“ („Verneinung“) und „Осознание“ („Wahrnehmung“), der Tonfall verändert sich, es wird zunächst wavig, dann hypnotisch dronig aus Piano, Schlagzeug und etwas Undefinierbarem sowie einfach nur „Metal Machine Music“. Genau so schließt als siebtes auch der Titeltrack – als Lärmorgie. Nicht einmal als Weißes Rauschen, dieses Rauschen ist Grau. Die Erleuchtung also verschwindet in kompletter Auflösung, in Gleichmachung, in Nivellierung, in einem dröhnenden Nichts.
Hier kann man allerlei Interpretation ansetzen, was es mit der Erleuchtung auf sich hat, was Samarin dazu geführt haben mag, sich auf den offenkundig beschwerlichen Weg zur Erleuchtung zu machen, warum er welche entscheidende Wegmarken für sich ausmachte, wie die ihm die Richtung deuteten, sich – ja: zu verlieren oder als unbedeutendes Element in ein alles umfassendes Dröhnen einzuordnen. Vor dem Hören klingt es verheißungsvoll, dass jemand musikalisch erleuchtet ist und die Hörerschaft daran teilhaben lässt, hinterher fühlt man sich fehlgeleitet, in die Irre geführt, denn nach warmer, umfassender, wohliger Erkenntnis klingt das hier nicht, sondern nach dem Gegenteil, und während man sich noch betrogen fühlt, reift die Erkenntnis, dass Samarin vermutlich komplett richtig liegt. Ein konsequentes Album also.
Alles zu haben auf Bandcamp