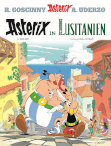Von Matthias Bosenick (27.10.2025)
Der 41. Asterix-Band ist der siebte Band der Reihe, der das Erbe von Uderzo und Goscinny aus anderen Federn weiterträgt. Zeichner Didier Conrad, der die frankobelgische ligne claire im Blut zu haben scheint, ist geblieben, an der Texttafel übernahm bereits beim Vorgänger „Die weiße Iris“ Fabcaro den Griffel von Jean-Yves Ferri. Diese Reise nach Portugal ist ein gelungener zeitgemäßer Remix dessen, was man an Asterix gut findet, mit der Annäherung an einige heutige Themen und Standards.
Ein Bisschen etwas von Baukasten hat dieses Abenteuer: Man erkennt die Elemente wieder, die einem seit Ende der Sechziger vertraut sind, nur anders angeordnet, gelegentlich sogar als Negation oder Auslassung. Dazu gehören die Reisen in fremde Länder, die Begegnung mit den Eigenheiten fremder Kulturen, die Griffe zu zeitgenössischen Themen und die Reaktivierung alter Nebenfiguren. Da fühlt sich der Klassiker-Fan so zu Hause wie der Neueinsteiger. Das funktioniert gut, weil die Autoren dazu eine nachvollziehbare Geschichte erdenken, die man sogar als Ermittlungs-Krimi auffassen kann, und die das Universum nicht allzuweit ausdehnt.
Hier bekommen also multinationale Konsortien und das Internet ihr Fett weg, während der Portugiese deprimiert frohlocken darf. In diesem Zusammenhang erfreut es, dass Obelix nicht so ausgeprägt als der unglaubwürdige dusselige Sidekick des superschlauen Superhelden auftritt, etwa analog Goofy und Micky, sondern sich die Eigenheiten des Lusitanischen sprachlich und inhaltlich zu eigen macht und dem draufgängerischen Duo damit einige Vorteile verschafft. Zudem weiß man sich hier inhaltlich auf der Seite der Behutsamen und Bedächtigen, die das Unwesen der Allianz aus Geld und Macht ebenso verurteilen wie den Rassismus, und sei er latent. So bekommt der Ausguck der Piraten erstmals das R spendiert, gleichzeitig, und das ist das Paradoxe, dürfen landestypische Stereotypen weiterhin als Gaglieferanten herhalten. Sei’s drum.
Seit der Übernahme von Conrad fällt in jedem Band auf, dass manche Dialoge etwas abrupt und willkürlich die Richtung wechseln. Schwer zu sagen, ob das am Original oder am Übersetzer liegt, aber bei Goscinny erlebte man so etwas nie. Naja, in den nachgereichten Dachbodenfunden von „Der kleine Nick“ schon gelegentlich, aber nicht bei Asterix. In diesem Band gibt es gottlob nur ein, zwei solcher holprigen Stellen. Immerhin: Die extrem schlechten Solo-Bände von Uderzo zwischen 1992 und 2005 lässt das neue Gespann hier vergessen. Das muss man auch mal schaffen: In fast 65 Jahren nur 41 Publikationen, davon zur Hälfte der Zeit wahlweise schlechte oder teils umstrittene Reanimationen aus anderer Hand, und trotzdem gilt Asterix als erfolgreichste europäische Comicserie. Da gibt’s einige nicht nur in Frankreich und Belgien, die sich ungläubig die Augen reiben.