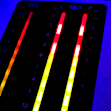Von Onkel Rosebud
Meine Freundin liebt die arte-Mediathek. Neulich äußerte sie, von den üblichen Streaming-Diensten mit ihrem zielgruppenorientierten Einheitsbrei die Nase voll zu haben und eine Pause von Netflix und Co zu nehmen, um sich künftig auf arte, die Fundgrube für Anspruchsvolle, zu konzentrieren. Sie hält das jetzt schon länger durch und das hat unter anderem dazu geführt, dass wir mitreden können, falls auf der nächsten Party in der Küche mal die Sprache auf den japanischen Autorenfilmer Yasujirō Ozu kommt.
In schöner Regelmäßigkeit nennen nämlich Kritiker seinen Film „Die Reise nach Tokio“, wenn nach den besten Filmen aller Zeiten gefragt wird. Es ist Ozus berühmtestes Werk und bringt seinen unverwechselbaren Stil am besten zur Geltung. Der besteht darin, mittels einer reduzierten Inszenierung bedeutsame menschliche Tiefen zu erkunden. Und wenn die Kamera gerade nicht statisch auf Augenhöhe einer am Boden sitzenden Person verharrt, streift sie über Eisenbahnschienen, rauchende Industrieschlote oder im Wind baumelnde Wäsche – minimal musikalisch untermalt und nach jedem Dialog gibt eine Pause, quasi zum Durchatmen.
Ein altes Ehepaar aus der Provinz besucht seine Kinder und Enkel in Tokio, muss jedoch feststellen, dass sich die Generationen inzwischen weitgehend auseinandergelebt haben. Vordergründig passiert nicht viel: Die Familienmitglieder tauschen nette Worte aus, essen zusammen, verbringen Zeit miteinander. Die Kinder schicken ihre Eltern für einige Tage in ein Kurbad, schließlich fahren die alten Herrschaften wieder zurück nach Hause aufs Land. Für heutige Sehgewohnheiten ist das schwarz-weiße Oeuvre auf Japanisch mit Untertiteln aus dem Jahr 1953 eigentlich eine Qual. Meine Hypothese, warum „Die Reise nach Tokio“ Darling der Kritiker ist, ist, dass sich die Kritiker dafür belohnen, 136 Minuten Selbsttest, nicht das Endgerät nebenbei zu bedienen, durchgehalten zu haben. Doch, wenn man sich auf Yasujirō Ozu einlässt, steckt hinter dieser unspektakulären Fassade ein Universum an menschlichen Emotionen und zu ergründenden Themen. „Die Reise nach Tokio“ ist kein Film über ein Problem, sondern einer über das Leben, nach dem Glück des Augenblicks. Wahrhaftig, anmutig, behutsam und gelassen.
Obwohl im Zentrum seiner Filme oft die Themen Familie und Ehe standen, war Yasujirō Ozu nie verheiratet und hat zeitlebens mit seiner Mutter zusammen gewohnt. Alkohol hat ihn dominiert. Er soll als Regisseur exzentrisch und perfektionistisch gewesen sein.
„Tokio ist eine große Stadt. Wenn wir uns hier verlieren, finden wir uns nie wieder“, bilanziert die Frau des alten Ehepaars zu ihrem Mann. Menschliche Größe in alltäglichen Situationen mit einem wohlwollenden Lächeln. Das war die Film-Welt von Yasujirō Ozu und der Grund, warum „Die Reise nach Tokio“ auch der beste Film aller Zeiten sein kann.
Welcher Film ist der beste aller Zeiten? Das ist natürlich hochgradig subjektiv. Egal, was man in der Rubrik nominiert, „Citizen Kane“, „Die Verurteilten“, „Fight Club”, „Müllers Büro” oder den 4. Teil von Harry Potter. Jeder hat seine eigenen Favoriten. So soll es sein.
Onkel Haruku Rosebud