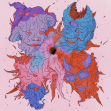Von Matthias Bosenick (19.+20.08.2021)
Ein weiterer Überblick vom fabelhaften Label addicted/noname aus Moskau, mit aktuellen und mit älteren Veröffentlichungen von: Mother Witch, Remote, Dogs Bite Back, Dusky Dive, Old Sea And Mother Serpent, The Moon Mistress, The Grand Astoria, Резина, Dead Man Tells und Злурад.
Злурад – Колбаса (2017)
Zum Einstieg ein Lärmbrocken: „Колбаса“ nennen Злурад aus Moskau ihr Debüt, „Würstchen“, und das Cover dazu zeigt einen abgeschnittenen Wurstfinger. So appetitlich ist auch die Musik: „Ритуал“ heißen sämtliche Songs, nur durchnummeriert, also „Ritual“, und wenn abgeschnittene Finger das Ergebnis dieses Ritus‘ sind, möchte man ihm nur ungern beiwohnen. Auch sonst ist das Würstchen nicht eben leicht bekömmlich, dabei handelt es sich im Original sogar um ein Geburtstagsgeschenk für die Sängerin: Im weitesten Sinne könnte man von einer Art Post-Hardcore sprechen, wäre da nicht der, nun, Gesang. Die vier Musiker Roman Karandaev (Trompete), Dmitry Kuzovlev (Bass), Ivan Khvorostukhin (Horn, Congas) und Violetta Postnova (Stimme) teilen sich das Mikro, nur Schlagzeuger Andrew Kim bleibt offenbar stumm. Und die vier krakeelen herum, dass es nur so eine Pracht ist.
Wenn das hier ein Geburtstag war, dann hatten die fünf wohl mächtig einen im Tee. Man könnte dem geschredderten Punk auch eine Neigung zum Free Jazz attestieren, wäre er nicht so extrem auf die Fresse gerichtet. Spätestens „Ritual 4“ wagt einen vorsichtigen Blick in Richtung Horns Of Dilemma, also wirrem Tröten, nur mit noch mehr Chaos. Noch mehr Chaos, ja! Kein Wunder, dass einige der Brüllenden da ins Husten kommen. Nach einer guten Viertelstunde ist die Party vorbei, und zwei Jahre später gab’s dann mit „Во благо злу“ einen Nachschlag. Nächstes Mal bitte eine Einladung, diese Partys müssen bemerkenswert sein!
Dead Man Tells – Среди мыслей (2021)
Das Saxophon dröhnt bassig wie bei Morphine, die Synthies schwirren wie im Spacerock, die Stimmen verhallen im All, die Musik erinnert an einen langsamen Disco-Blues, zu dem man bewusstseinserweiternde Substanzen einatmet, vom Nachbartisch herüberwehend selbstredend. Für „Среди мыслей“, „Unter Gedanken“, die erste Single seit 2018, verkürzen Dead Man Tells No Tales aus St. Petersburg ihren Bandnamen, tauschen ihre Besetzung ordentlich aus (vom ursprünglichen Quartett aus dem Jahr 2015 sind im gegenwärtigen Quintett nur noch wenige Namen wiederzufinden; mit dabei sind hier: Stanislav mit Gesang und Synthesizern, Daniil mit Schlagzeug und Synthies, Yuriy mit Gitarren und Synthies, Konstantin mit Bass sowie Victor mit dem Saxophon) und ufern musikalisch ordentlich aus (jedoch nicht in Richtung Nikki Sudden). Sechseinhalb Minuten dauert der Ausflug in ein Paralleluniversum, in dem man sich bereitwillig einnisten würde. Es darf gern ein Bisschen mehr sein!
Резина – Секрет feat. Tresvyatski (2021)
Auf das sehr geile Album „1619“ lassen Резина aus Moskau die Single „Секрет“ folgen, „Geheimnis“. Passend zum Konzept gibt es auch bei diesem Song einen Stargast aus der russischen Untergrundszene, und zwar Sänger Igor Volkov von Tresvyatski und The Omy. Vom einstigen Punkrock und dem nachgereichten Hardcore von Резина ist hier nichts im klassischen Sinne zu hören; dieser Song ist das Ergebnis mehrerer Häutungen und Evolutionen. Vertrackte Rhythmen wie im Mathcore bekommt man im Mittelteil, drumherum gibt’s eine Art Alternative Rock, nur ohne den Blick auf erhöhte Verkaufszahlen, sondern geschmackvoll eigensinnig, und gegen Ende driftet das Stück vorübergehend in eine Art Ambient oder Post Rock. Eine Wundertüte im Kleinformat, ein Spiegelbild von „1619“ von einer grandiosen Band. Die besteht aus: Ilya Zinin (Gitarre), Andrey Klimov (Gitarre), Dmitry Sirotkin (Bass) und Dmitry Drozdov (Schlagzeug) – Sänger borgt sich das Quartett stets aus.
The Grand Astoria – The Slowest Guitar Alive (2021)
Das stimmt natürlich nicht, „The Slowest Guitar Alive“ ist nicht bei The Grand Astoria aus St. Petersburg zu hören, da dürften Kollegen wie Bohren & Der Club Of Gore oder Boris ein Wörtchen mitzureden haben. Kurioserweise geht es bei dieser halbstündigen instrumentalen EP aber um jemanden, den man im Kontext von Progrock, Doom und Psychedelic eher nicht so sehr erwartet hätte: Roy Orbison nämlich, von dem Bandkopf Kamille Sharapodinov ein großer Fan ist und an dessen Western „The Fastest Guitar Alive“ aus dem Jahr 1967 sich diese EP anlehnt. Das spiegelt auch das von Sophia Miroedova gestaltete Cover wider, das das der Roy-Orbison-LP in Schriftart und Motiv in typischer The-Grand-Astoria-Art kopiert, nur dass hier der Hintergrund schwarz statt weiß gehalten ist und statt Cowboys und Indianern auf Pferden das Bandmaskottchen mit dem Tierschädel auf einer Schildkröte reitend mit der Gitarre Aliens auf Schnecken abwehrt. So geht das.
Die Songs hingegen sind eigen und beziehen sich vielmehr auf die Comeback-EP „From The Great Beyond“ aus dem vergangenen Jahr. So spacig wie das Cover ist auch die Musik, dabei trotzdem partiell ausgesprochen heavy und sich auf weiten Strecken in Gegniedel verlierend, wie es sich gehört. Dazu gibt’s zweimal Georgel, und sobald das erstmals einsetzt, bekommt die Musik einen unerwarteten Kirmesgeschmack. Das im Titel angedeutete Tempo behalten The Grand Astoria tatsächlich bei; verantwortlich sind hier außer dem Gitarristen und Geräuschemacher Sharapodinov noch Kirill Ildyukov (Gitarre), Konstantin Smirnov (Schlagzeug), Danila Danilov (Bass) und Denis Kirillov (Nord Organ). Das Universum von The Grand Astoria ist unermesslich groß und diese EP nur ein minimaler, aber großartiger Einblick in diese Größe.
The Moon Mistress – Silent Voice Inside (2012, Reissue 2020)
Hier wird’s düster: In lediglich Triobesetzung kreieren die Moskauer The Moon Mistress einen Doombrocken mit Black-Sabbath-Muttermilch, den addicted/noname nun fast eine Dekade später mit vier Zusatzstücken neu auflegt. In klassischer Besetzung versetzen Garish (Gitarre und Gesang), Memphis (Bass) und Mitya DHS (Schlagzeug) den geneigten Hörer in eine tiefdunkle Trance. Zu der die Songtitel bestens passen, „Cease To Exist“, „Cremation Meditation“, wer mag dazu nicht entspannt chillen!
Es erstaunt einmal mehr, welchen Druck und welches Gewicht nur drei Musiker mit ihren Instrumenten entwickeln können, mit fuzzy Distortion zumeist, und wie eingängig die Musik dabei trotzdem ist. The Moon Mistress haben dabei keine Eile, sie walzen ihre Stücke episch aus und schleppen ihre Riffs über Ausdauer ins Ziel, nicht über Tempo. Wenngleich ebenjenes „Cease To Exist“ tatsächlich mal die Zügel locker lässt und einen räudigen schwarzen Bluesrock vor die Kutsche spannt oder „Samsara“ am Ende mit einem punkigen Galopp überrascht. Und sie haben Wahwahs!
Von den vier reichlich ungestümen Bonus-Tracks zu den ursprünglichen neun gab es zwei bereits auf der Kassetten-Version des Albums zu hören, davon ist einer, „Entropy (Энтропия)“, ein Cover, und zwar von Гражданская Оборона (Grazhdanskaya Oborona), Punk-Indie-Helden aus Omsk, die seit den Neunzigern aktiv sind. Zwei weitere Bonusstücke stammen aus späteren Sessions, die das Trio 2012 absolvierte. Erstaunlich ist, dass es von der Band bis auf einige Singles kein weiteres Album mehr gab.
Old Sea And Mother Serpent – Plutonian (2021)
Besonders eilig hat es das Duo Old Sea And Mother Serpent aus Yegoryevsk nicht, und zwar in jeder Hinsicht: Satte neun Jahre sind seit dem Debüt „Chthonic“ vergangen, und in dem Tempo bewegt sich auch die Musik von Anthony und Eugene. Der Doom schleppt und schleppt sich, Anthony brüllt und growlt, ab und zu gniedelt Eugene, ansonsten machen die beiden eher Fläche als Landschaft. Entsprechend lang sind die vier Songs dieses Albums: drei über 20 Minuten, einer elf. Und weil diese Länge auch attraktiv gefüllt sein will, nehmen die beiden Musiker bisweilen die Verzerrer aus dem Raum und lassen ihre dunkle Musik klar erklingen, schalten mal den Fuzz dazu, klingen wie eine groovende Tanzparty in der Folterkammer, lassen ihre Gitarren auch mal in höchsten Tönen tirilieren oder vergessen, ihren Synthesizer auszuschalten, der dann minutenlang vor sich hin dröhnt.
Nicht nur damit bringen die beiden eine unerwartete Abwechslung in die Stücke: Einfach nur lang ist auch ihnen nicht genug, da muss etwas passieren, und es passiert etwas. Es gibt mithin mehr Abwechslung innerhalb der einzelnen Tracks als zwischen ihnen: Den Übergang von „Wereserpents“ zu „The Scrag Temple“ etwa nimmt man nicht wahr.
Das Duo hat einen langen Atem, Zeit und Raum spielen keine Rolle, und ob man nun bereits seit zehn Minuten paralysiert mit dem Kopf nickt oder über eine Stunde, macht bei der lebensverneinenden Stimmung dann auch nichts mehr aus. Immerhin hat man diese dunkle Stunde dann mit angenehmer Musik verbracht. Ja, „Plutonian“ rockt! Auch. Denn manchmal braucht man für den amtlichen Bluesrock auch mal Hilfe von Zauberern, scheint es.
Dusky Dive – Flanger Studio Session (2021)
Das Album zur Vorabsingle „Sky“, die hier ebenfalls enthalten ist: Die „Flanger Studio Session“ von Dusky Dive ist offenbar tatsächlich einfach im titelgebenden Räumen einfach so entstanden, und wenn dem so ist, kann man nur staunen. Wer so schlüssige Stücke improvisiert, hat definitiv etwas drauf. Die Songs, auch mit ihren jazzigen, experimentellen Passagen, sind um Längen überzeugender als sauviele durchkomponierte Indiesachen dieser Zeit. Markant ist hier natürlich das Baritonsaxophon, das wie bei Dead Men Tells angenehm an Morphine erinnert.
Genregrenzen kennen die vier aus Moskau keine. Zwischendrin wird ein mostiger Rocksong zum Ska, ein Track eröffnet mit Industrial, irgendwo wehen Tumbleweeds durch eine leere Wüstenlandschaft, die Band verliert sich in mitreißendem Gniedeln oder kreiert die fröhlichsten Popsongs: Man kann nur ehrfürchtig niederknien davor, dass all dies improvisiert sein soll. Die wissen, was sie tun: Gitarrist Sergey Plishka, Baritonsaxophonist Ivan Izmalkin, Bassit und Sänger Aleksey Stanchinskiy sowie Schlagzeuger Grigory Perelman.
Eine gute halbe Stunde dauert dieses Impro-Debüt, das wirkt, als wäre es weit länger, weil es so abwechslungsreich ist. Und über allem schwebt dieses wundervolle Saxophon, das hier zwar die jazzige Note einbringt, aber nicht als Lärm, den besorgen im Zweifelsfall die anderen drei Musiker. Gelungen!
Dogs Bite Back – Back? Forward! (2021)
Ganz anders das Trio Dogs Bite Back aus Moskau: Hier fügt sich kein Ton in etwas Hörbares, in keine Struktur, in keine Melodie, keinen Rhythmus, keine Schönheit. Hier regiert das Chaos, die Dekonstruktion obsiegt, die Freude am Protest, beim Hörer hingegen die Fassungslosigkeit über den Wagemut, dieses akustische Abenteuer überhaupt zu veröffentlichen. Hier scheint alles dem Zufall überlassen zu sein, nichts fügt sich in Vertrautes. Das muss man erstmal verdauen.
Das Trio spielte die sechs Tracks, genau wie Dusky Dive, live und improvisiert im Studio ein. Mit einem üppigen Fuhrpark: Der in diversen Projekten und Bands aktive Ilia Belorukov brachte seinen Modular-Synthesizer mit, Dmitry Lapshin von Brom den Bass und eine Armada an Effektpedalen sowie Konstantin Samolovov vom Experimental-Projekt Wozzeck sein Schlagzeug, diverse nicht näher benannte Objekte und einen Apparat namens Voice Recorder.
An manchen Stellen klingt die Musik wie das Ende der Skala beim Mittelwellenradio oder beim Einwählen ins Internet mit dem 56k-Modem. Es überwiegt der scheinbar willkürliche Sound des Synthesizers, der hier eben nicht eingesetzt ist wie beim Synthiepop, da mache man sich keine Illusionen. Tatsächlich gönnen sich die drei mitten im elfminütigen „Are You Serious?“ und im neunminütigen „Ga-Ga-Gah“ Passagen mit fortlaufendem Takt, so ist das ja nicht. Von einer Songstruktur kann deshalb aber noch lang keine Rede sein. Dieses Album ist mindestens eine Herausforderung.
Remote – Дым (2021)
Herausfordernd ist auch der Gesang bei Remote, der dem Hardcore entliehen ist, wohingegen es sich bei der Musik eher um Stoner-Metal handelt, um Sludge mithin. Da bleibt das Trio genretreu: Sechs Stücke in einer Dreiviertelstunde, Dreivierteltakt, tiefergestimmte verzerrte Saiteninstrumente, Einsatz von Effektpedalen; da sind nicht nur die Musiker zugedröhnt, sie dröhnen die Hörerschaft ihrerseits zu. Nicht umsonst lautet der Titel des Albums „Дым“, also „Rauch“.
Der Kontrast zwischen der brüllenden Stimme und der weniger aufs Brüllen ausgerichteten Musik macht das Album natürlich erst interessant, weil: Herkömmlich kann ja jeder. Mit dem Geschrei strahlt das Trio Energie aus, die es mit der Musik wieder abfängt; die Stimme prescht nach vorn, die Musik lehnt sich zurück. Dieses Spanungsverhältnis muss man ertragen, denn lässt man sich vorrangig auf den Sludge ein, kann das Herumschreien durchaus nerven. Charmant ist wiederum, dass dieses Brüllen auf Russisch stattfindet, also einen weiteren sympathischen Kontrast darstellt für Hörer, die kein Russisch können. Und spätestens, wenn die drei dann in den klassischen Black Metal driften, weiß man, dass sie nicht nur kiffen können.
Dabei ist das offenbar Hauptsujet von Nikita, Evgeny und Sasha. Zumindest legen das Cover und Titel der früheren Alben nahe, die sie seit 2012 veröffentlichten. Irgendetwas muss sich aber um 2018 ereignet haben, danach wurden die Cover nämlich schwarz statt grün. Wie die Musik. Und wenn die vieltönnige Walze „Дым“ dann über einen hinweggefegt ist, möchte man sich dringend die Ohren freipusten.
Mother Witch – Mother Witch & Dead Water Ghosts (2014)
Was Mother Witch auf ihrem Debüt streckenweise anbieten, ist so sehr vom Postrock durchdrungener Doom, dass es fast schon Gothic ist. Bald gesellt sich ein monumentaler Groove dazu, größer noch als der, den selbst die Fields Of The Nephilin einst hatten; damit ist die Nähe zu Stoner doch größer. Mal wieder belegen die vier Musiker aus Odessa, wie weit der Horizont der meisten Bands auf addicted/noname ist, denn festlegen sollen sich andere, spannend wird es, sobald man über den Tellerrand blickt und das selbst gewählte Universum um Nachbarareale erweitert.
Und das geschieht auf „Mother Witch & Dead Water Ghosts“ ausgesprochen virtuos. Die Band verbindet die Elemente nicht nach Baukastenart, sondern fluid und nachvollziehbar, nicht vorhersehbar; ein Bluesrock als Basis für etwa „Ceremony“, „Whisper“ oder „Homeway“ passt wie die Faust aufs Auge, während „Shallow Grave“ eher ins Richtung Psychedelic driftet. Interessanterweise erinnert der Umstand, dass hier eine Frau singt, wiederum sehr an The Eden House, also deren Trip Goth, wie die ihren Stil nennen. Und doch mag man irgendwo im Hintergrund bisweilen die alten Black Sabbath herumgeistern hören. Auf Extreme indes verzichten Mother Witch, trotz der, nun, dunklen Grundhaltung, der großen Nähe zum Doom und der nachdrücklichen Spielweise kommt es nicht zu Gewaltausbrüchen.
Zur Band gehören hier Sängerin Maria Teplitskaya, Gitarrist Egor Walovski, Bassist Vitaliy Zhavnerchik und Schlagzeuger Alex Petrov. Nach diesem Auftakt erschien mit „Ruins Of Faith“ 2015 das zweite Album, bei dem die Band ihren Namen um den Zusatz aus dem Titel des Debütalbums erweiterte. Vor vier Jahren folgte mit „Ode To A Cold Heart“ ein einzelner neuer Song, seitdem ist es ruhig um die Ukrainer. Bedauerlich, aber dann hört man das Debüt eben öfter.
Zu bestellen auf Bandcamp