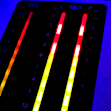Von Onkel Rosebud / Matthias Bosenick
Zum Geleit: Mit diesem Text geht es mir nicht darum, mich über den Geschmack anderer Leute zu stellen. Vielmehr berichte ich davon, wie mir in Zeiten schlimmster Orientierungslosigkeit ein heller Stern eine neue Richtung wies.
Eine Autofahrt als Beifahrer des Jahrgangsslackers änderte im sommerlichen Frühjahr 1991 alles. Bisher hatte ich in dem festen Glauben gelebt, dass Musik, die nicht in den Charts war, schlecht sei, weil sie ja schließlich ansonsten in den Charts wäre. Den umgekehrten Schluss, dass mir nämlich auch Musik aus den Charts nicht gefallen könnte, ließ ich dabei zu, schließlich traf ich bei meinem Konsum eine Auswahl. Bis 1989 fuhr ich damit auch ganz gut, und noch bis heute mag ich einen großen Teil dessen, was ich damals für mich entdeckte. Allem voran mochte ich den Synthiepop mit seinen ausufernden Maxiversionen. Ein mögliches Ende dieser Ära zog ich nie in Betracht, und doch ereilte es die Musikwelt und damit meinen Musikgeschmack ungefähr 1990, also knapp nach dem Mauerfall.
Auch wenn die Achtziger weithin als das Plastikjahrzehnt gelten, waren die Charts nie vorher und nie mehr danach derart divers. Selbst Bands aus Punk, Postpunk, Gothic und allerlei weiteren Untergrundspielarten hatten ihre 15 Minuten, und sei es dadurch, dass sie gefälligeren Epigonen den Weg ebneten, die entsprechende experimentelle Elemente im Radio unterbrachten. Damit überlisteten mich die Charts also, ohne dass ich es damals begriff: Ich hörte längst Nichtchartsmucke, der es lediglich gelungen war, ihren Fuß in die Tür zu kriegen, in meine oder in die des Weltengeistes. Ich konnte ja nicht im Internet ermitteln, womit ich es da zu tun hatte, sondern vertraute einem unbestimmten Regulativ, das wohl dafür sorgte, dass die einfach zugängliche Auswahl via Radio auch ihre Richtigkeit hatte. Letztlich formte dieser infiltrierende Umstand mein Gehör und machte es später den noch schrägeren Sachen einfacher, mich zu erreichen. Sobald ich dazu bereit war.
Das war ich 1989 noch nicht, weil es dazu für mich trotz erster Signale noch keinen Anlass gab. Meine Helden veröffentlichten stilsicher ihre atmosphärischen Maxiversionen, wie sie es das gesamte Jahrzehnt übertaten, und wiegten mich in Sicherheit. Nur ein Jahr später ging diese indes nahezu abrupt verloren. Es gab noch einige Relikte dessen, was mich berührte, aber als hätte jemand einen Schalter umgelegt, dominierten nach meinem Empfinden unsäglich schlimme Sounds, Rhythmen und Songs das Jahr. Statt wohlkomponierter Popmusik überwogen offenbar schnell und plakativ produzierte Tanzflurfüller die Charts. Tapfer versuchte ich, mich durch ein für mich abschreckendes Angebot zu kämpfen und meine Linie wiederzufinden, immer mit der Hoffnung im Herzen, es handele sich lediglich um so eine Phase, die dann auch schnell wieder vorbei wäre. Doch meine Geduld wollte und wollte sich nicht auszahlen.
Gleichzeitig wehrte ich mich aber noch gegen die Einflüsse, die von anderen Seiten auf mich einzuwirken versuchten. Wichtigster Richtungsweiser war da meine Mutter, die überall dort, wo sie sich nicht auskannte, den Teufel witterte, vornehmlich, sobald verzerrte Gitarren involviert waren. Das Radioprogramm hielt sie für sauber und ich übernahm unreflektiert diese Fehleinschätzung. Entsprechend abweisend stand ich allem anderen gegenüber: Bereits in den Achtzigern hörten einige Mitschüler Heavy Metal, was mir ob seines Lärms und seiner Symbolik zunächst noch nicht behagte, und ungefähr 1990 kam aus anderen Richtungen die Klassifizierung Indie dazu, mit ihren für mich unübersichtlichen Subgenres und unzähligen scheinbar unhörbaren Songs. Nein, da blieben nur die Charts.
Mehr als ein Jahr lang nun lieferte ich mich einem Radioprogramm aus, das mich verwirrte und mir die Orientierung nahm. Eine schlimme Zeit für mich. Und also drangen die obskuren Töne der Indiebands zuhörends deutlicher an mein Bewusstsein heran und versuchten, sich mir als Alternative zu empfehlen. Standhaft weigerte ich mich noch eine ganze Weile lang gegen sie, stets auf die Rückkehr des großen Pops hoffend.
Bis zu meiner Kapitulation. Frühjahr 1991. Es gab eine schulische Veranstaltung, die sich bis in den Nachmittag ausgedehnt hatte. In der südlichen Lüneburger Heide war man aufgeschmissen, sobald man auf die öffentlichen Verkehrsmittel angewiesen war, und so erwarb ein jeder Jugendlicher beim Eintritt in die Volljährigkeit zunächst die Fahrerlaubnis, und sofern es finanziell möglich war, alsbald auch den entsprechenden mobilen Untersatz dazu. Von Hankensbüttel nach Wesendorf waren es 16 Kilometer, eine recht geringe Distanz, verglichen mit der, die etwa Mitschüler aus der Gegend von Brome zu überbrücken hatten. Also hatten viele Jugendliche ein Auto, und trotz der dünnen Besiedlung ergaben sich Fahrgemeinschaften, wenn man bereit war, Umwege in entlegene Nachbardörfer in Kauf zu nehmen, solche wie Kiebitzmoor, Weißenberge oder Texas. Das Glück war mir nun an jenem Nachmittag hold, ich erhielt einen Platz auf dem Beifahrersitz des orangefarbenen Schweinepolos eines Mitschülers, der mehrere Orte weiter wohnte, in Betzhorn. Wir starteten die Fahrt in Richtung Oerrel und Andreas schaltete seinen eingebauten Kassettenspieler ein.
Rockmusik. Hart, aber kein Metal, so viel erkannte ich als Laie dann schon. Eine dringliche Stimme skandierte etwas zu einer Musik, die nicht durchgehend erklang, sondern merkwürdige Breaks machte. Es brauchte eine Weile, bis ich die Struktur der Strophen erfasste. Der Refrain unterließ diese Brüche und zog sogar noch das Tempo an. So etwas hatte ich noch nie zuvor gehört. Von wegen unhörbare stümperhafte Geräusche, dieses Indie hatte Groove, Melodie, Eigenwilligkeit, Akkuratesse, Ungestüm und Wohlklang und erreichte mein Herz sofort. Da staunte ich selbst, der bis dahin so massive Widerstand war im Handumdrehen gebrochen.
Natürlich blieb die Frage nicht aus. Ich stellte sie aber erst, als der Schlussakkord verklungen war und das konservierte Publikum sein Gefallen austobte. Es handelte sich um das Live-Album der linkspolitischen Folkrocker New Model Army, die unter dem Anagramm Raw Melody Men unterwegs gewesen waren und den Mitschnitt dazu einfach nach diesem Alter Ego benannt als Album veröffentlichten. Und der betreffende Song, der mich bekehrte, war „Innocence“.
Dieser Moment veränderte alles. Es war wie ein Dammbruch. Alles hielt fortan Eingang in mein Gehör, Grenzen waren nicht wahrnehmbar, und wenn doch, ließ ich sie niederreißen. Mein musikalischer Horizont erweiterte sich in nie für möglich gehaltene Dimensionen. Mein Verhältnis zu den Charts indes änderte sich nachhaltig: Es fiel mir fortan schwer, darin überhaupt noch etwas zu finden, das Einzug in meine Sammlung hielt. Zu meinem früheren Glauben entwickelte ich zudem quasi eine Antithese, die meine erste These nunmehr ums mehr als Dreifache überdauert. Und New Model Army gibt es nicht nur immer noch, sie veröffentlichen auch noch regelmäßig herausragend gute Alben.
Another little death of innocence.
P.S.: Dieser Text erschien zuerst im Buch „Various Artists – Ich liebe Musik Vol. 2“ (2020, Windlust Verlag) und wurde von Matthias Bosenick über den Song „Innocence“ von New Model Army geschrieben.