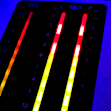Von Onkel Rosebud
Ich gebe zu: Von der Künstlerin Beyoncé habe ich kaum eine Ahnung. Sie war in den Neunzigern in irgendeiner Girlband und damit eine der ersten erfolgreichen Woman of Colour, hat es zweimal auf ein Spex-Cover geschafft und ist mit so einem Typen liiert, der ein einflussreicher Hip-Hop-Musiker sein soll. Außerdem scheinen geschlossene Ober- und Untertrikotagen nicht ihr Ding zu sein. Ich erinnere mich auch, mal irgendwo gelesen zu haben, dass eine australische Pferdebremse nach ihrem Hinterteil benannt wurde…
Als aktiver Schallplattenunterhalter im öffentlichen Raum passiert mir aber seit Jahren immer derselbe Dialog. Zur vorgerückten Stunde tritt eine leicht angeschwippste und verschwitzte jüngere Teilnehmerin der Tanzveranstaltung an mich heran, meistens mit Verstärkung in Form einer Freundin, weil ich von Natur aus unfreundlich aussehe, und brüllt mir ins Ohr: „Wann spielste endlich mal was von Beyoncé?“. Ich sage dann erst einmal nichts, weil ich bei so Vorwürfen nicht unfreundlich reagieren will, aber mein Gesicht macht „Puh“. Das habe ich leider nicht unter Kontrolle. Die Freundin untersetzt den Wunsch nach weiblichen US-amerikanischen Rhythm and Blues und schreit „Passt doch gerade super“. Da ich mir nicht leisten kann, gleich zwei Mädels den Abend zu verderben, frage ich zurück: „Okeh, welchen Song?“ Und dann kommt als Antwort, die ultimative Beleidigung, die ich mir als DJ immer wieder anhören muss: „Na, einen schönen“. Zerknirscht gucke ich dann im Internetz, welches Video der Dame gerade die meisten Klicks hat, und baue das dann ohne vorher reingehört zu haben in die nächsten drei Lieder meines Sets.
Das konnte nicht so weitergehen. Regel Nummer 1 bis 3 des DJ-Kodex’ besagen, spiele nie einen Song, den du nicht kennst, verliere nie die Kontrolle über die künstlerischen Inhalte deiner Performance, sei aber trotzdem ein Publikumversteher. Deshalb startete ich an einem trüben Samstag im April den Selbstversuch, mir alle Solo-Tonträger von Beyoncé anzuhören, in der Hoffnung, mindestens einen guten zu finden, der glaubwürdig in meinen geschmackssicheren musikalischen Vortrag passt. Vorher hatte ich ermittelt, dass mich das reichlich sechs Stunden Lebenszeit kosten wird, weil ich mir vorgenommen hatte, nicht zu skippen. Aber bereits beim Erstling „Dangerously In Love“ aus dem Jahr 2003 brach ich mit meinen guten Vorsätzen. Das schlimmste sind die Balladen, die vermehrt im jeweils letzten Drittel der sieben Platten auftauchen. Offensichtlich gingen den Produzenten irgendwann die Ideen aus und sie dachten wohl, zärtlich sopraniert à la Mariah Carey geht immer. Songs wie „The Closer I Get To You” feat. Luther Vandross, „Resentment“ aus „B’Day“ (2006) oder „No Angel“ und „Heaven“ („Beyoncé“ 2013) lassen das Blut in meinen Ohren gefrieren. Ich bekomme Symptome körperlicher Verweigerung für Mezzosopran. Gänsehautschauer laufen über meinen Rücken wegen des akustischen Schmerzes, den diese stilistische Verirrung verursacht.
Insgesamt nimmt die Balladendichte im Laufe ihrer Karriere bis zum letzten Album „Renaissance“ (2022), welches in vielerlei Hinsicht anders und frischer ist, zu. Deshalb sind „4“ (2011), „Lemonade“ (2016, außer dem Song mit Kendrick Lamar) und die Seite 1 von „I Am… Sasha Fierce“ (2008) gruselige Perlen der Unhörbarkeit. Dafür ist die 2. Seite der Sasha-Fierce-Alter-Ego-Platte ziemlich gut, weil schön Missy-Elliot-mäßig.
Fazit: Beyoncé Giselle Knowles kommt zwar aus Houston und wäre auch gern gesanglich eine Whitney. Leider mangelt es dazu an Talent. Wenn der einflussreiche Ehemann musikalisch mitmischt oder ein Duett ansteht, dann groovt’s meistens. Man kann zu ihrer Musik gut nass wischen und sich australische Pferdebremsen der Art captia beyonceae dazu vorstellen.
Ach, und um die Gunst meiner Partyteilnehmerinnen zu erhalten, habe ich mich für den Song „Telephone“ entschieden. Weil, wenn sich jemand auch noch Lady Gaga wünscht, dann kann ich sagen: „Hab‘ ich doch schon gespielt“.
Onkel Rosebud