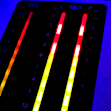Von Onkel Rosebud
Unvorstellbar, obwohl schon fast 60 Jahre tot, John Coltrane könnte heute theoretisch noch leben, abseits von Dancefloor-Jazz und Kuschel-Rock, von Easy Listening, Pop-Klassik zum Träumen und Vivaldi für Gestresste. Er könnte noch leben, hundertjährig, in seinem eigenen musikalischen Universum, und trotzdem wie alle demokratisch ereilt von dieser akustischen Kontaminierung des Alltags durch den Ohrenschmaus aus Aufzügen, Kaufhäusern, Wartezimmern, Restaurants: Ein Triumph der Musik und ihrer Ausbreitung im Leben, und zugleich ihre Überführung ins Massengrab der Belanglosigkeit. Was würde er wohl heute dazu sagen?
Denn John Coltrane glaubte, das Universum in die Musik zu bringen und die Grenzen des Hörbaren erweitern zu müssen. Auch er wurde zeit seines Lebens von Stimmen begleitet, die ihn verachtet, herabgesetzt, ja diffamiert haben. Von Lärmbelästigung war die Rede, von der Zerstörung der Musik und kakophonischer Verwirrung. Der, der selbst niemanden hasste, wurde gehasst für die Obsessionen seines Spiels. Die Aggression, die er ausgelöst hat, hängt vielleicht auch mit der Freiheit zusammen, die er artikuliert, mit der Unbeirrbarkeit, die er verkörpert hat. Für dieselbe ist er geliebt, gefeiert, von manchen fast wie ein Heiliger verehrt worden. Den Weg seines musikalischen Lebens und Nachlebens begleiten die Stimmen derer, die ihm einige der glücklichsten und tiefsten Erfahrungen mit Musik überhaupt verdanken. Zu denen gehöre nämlich auch ich.
John Coltrane starb 1967. Da war ich noch nicht einmal geboren. Trotzdem bin ich über seinen Tod immer noch nicht hinweg. Würde er noch leben, könnte ich ihn mir nicht als Assistenzmusiker vorstellen, nicht als einen, der Standards wieder aufnimmt, Coverversionen kompostiert, eigene Bestseller neu arrangiert. Ich kann mir Coltrane auch heute nur als den Paten einer neuen Musik vorstellen, einen verrätselten Weisen, einen Alten auf der Schwelle zu einem neuen Territorium des Hörbaren, das er selbst immer weiter vor sich aufrollt. Denn genau das war seine Anstrengung über weit mehr als die Hälfte seines vierzigjährigen Lebens.
Coltranes Musik fehlt, weil sie radikal war, weil sie sich allein der Seele der Musik verpflichtet fühlte und nicht zuletzt aus dem schlichten, aber gewichtigen Grund, weil sie nicht kommerziell war. Trotz aller Beschönigungen ist dies wahrscheinlich die Frage, die alle kulturellen Produktionen kategorisch unterscheidet: Wollen sie primär verkäuflich sein, oder wollen sie primär ihr Medium erkunden, es verändern und umbilden? Nicht auszudenken, welche Kultur entstünde, müsste sie nicht verkauft werden. John Coltrane ist der Inbegriff des unkommerziellen Musikers, und er ist auf dem Weg über die Grenzen dessen hinaus, was man als Musik vor ihm kannte, auch zu einem der befreiendsten Musiker der Musikgeschichte geworden. Man kann ganz einfach und pathetisch sagen: Nach ihm war in der Musik nichts mehr wie zuvor. Er hat das Gesicht der Musik verändert, er hat es für alle Zeiten verändert.
Man sollte also nicht verlangen, ihn, den König des Tenorsaxofons, sofort, an jeder Stelle und auf Anhieb verstehen zu können, man sollte ihm nicht mit dem Konsumverhalten begegnen, das die millionenschweren Ohrwurm-Produktionen des Pop-Adels erlauben, vielmehr sollte man sich bei der Durchquerung des Werkes von John Coltrane auf eine lange Reise gefasst machen, eine Reise durch den ganzen Horizont eines Lebenswerkes wie in die Tiefe der Musik selbst.
Onkel Rosebud
P.S.: Dieser Text ist in Teilen inspiriert von einem längeren Aufsatz von großen Roger Willemsen. Auch er fehlt.