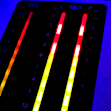Von Onkel Rosebud / Axel Mewes
Eine Freundin hat mir mal von ihrer Beobachtung erzählt, dass Männer – anders als Frauen – diese eine große Liebe hätten. Die sie bis zum Ende ihrer Tage im Herzen tragen, ganz gleich, was in ihrem Leben passiert. Sie hat recht. Wobei es bei mir und der Musik ein bisschen komplizierter ist.
Das erste Kribbeln in den Trommelfellen spürte ich im Alter von 10 Jahren. Meine große Schwester besaß einen Kassettenrekorder; irgendwann öffnete sich ihre Zimmertür, hinter der „Equinoxe“ von Jean-Michel Jarre lief. Ein andermal nuschelte Udo Lindenberg durchs Sternholzimitat, „Live Rust“ von Neil Young war gerade erschienen, Mark Knopfler zupfte die „Sultans Of Swing“. Anfänge des musikalischen Jugendlebens, während samstags nach der Schule Mutter die Fenster zu Lord Knuds „Evergreens à Go Go“ vom RIAS Berlin putzte. Was auch irgendwie fetzte, weil die Frau, der ich für den Rest meines Lebens den Satz „Fürs Tanzen hätte ich das Vaterland verraten!“ zuschreiben werde, die Gassenhauer lauthals fröhlich mitsang und in meiner Erinnerung samstags IMMER die Sonne schien. Wochenend‘ und Sonnenschein. Und Musik.
Bis zur großen Liebe sollte es noch ein paar Jahre dauern, denn auch in musikalischer Hinsicht war ich ein Spätentwickler. Durch die Pubertät halfen mir – seit der Jugendweihe unterstützt durch einen eigenen Babett-Rekorder – Nenas erste beiden Platten und ab 1983 Depeche Mode. Ansonsten nahm der Kleinstadtjunge popkulturell alles mit, was die Achtziger zu bieten hatten – mit voller Verachtung für die Machenschaften von Dieter Bohlen und Michael Cretu selbstverständlich! New Wave statt Rock und Blues, Trevor Horn statt Stock Aitken Waterman. Ich war ein artiger Junge, meine Freizeit bestand an fünf Nachmittagen die Woche aus Training, am sechsten aus Bolzen mit Freunden und dem Spiel am Sonntag. Personen bzw. Umstände, gegen die es sich vor 1989 zu revoltieren lohnte, gab es jenseits nervender Lehrer und konditionsbesessener Fußballtrainer für mich wenig. Das bisschen Zeit, das übrig blieb, gehörte der Musik.
Dabei wurde allerdings immer klarer, dass diese nur deshalb auf dem zweiten Platz meiner Freizeitaktivitäten gelandet war, weil der Sport keine Nebenbuhlerin duldete. Es gibt nicht viel, was ich im Rückblick auf meine Jugend anders machen würde, wenn ich es könnte. Dass ich zweimal die Woche Training gegen das Erlernen eines Musikinstruments tauschen würde, gehört dazu. Da Schule und Sport zwei völlig unterschiedliche Welten ohne personelle Überschneidungen waren, hatte ich zwar reichlich Klassen- und Mannschaftskameraden, mit denen ich auch gut zurechtkam, aber keine wirklichen Freunde. Ich verbrachte einfach zu wenig freie Zeit mit ihnen. Dasselbe galt für meine Familie, die ich eigentlich nur zu den Mahlzeiten an den Rändern des Tages und die eine Stunde bis zum Schlafengehen sah.
Ich vermute, dass die Musik deshalb früh den Platz des besten Freundes und später den der ersten Freundin einnahm. Sie war da, wenn ich sie brauchte. Sie kümmerte sich um mich, sie gab mir Kraft, Anerkennung und Trost und sie erzählte mir die Geschichten, die mir sonst niemand erzählte. Sie war die Erste, für die ich etwas Besonderes empfand. Depeche Mode raubten mir die musikalische Unschuld und ließen mich dann zehn Jahre nicht los, obwohl es nach dem ersten Rausch eine Menge neuer Beziehungen gab. Heute schaue ich mit wohlwollender Gleichgültigkeit auf die hyperventilierenden DeMo-Aficionados, die der Band auch im fortgeschrittenen Alter noch auf Ihren Europa-Gigs hinterherfahren. Ich höre in neue Alben gern mal rein, aber wenn ich mal ein paar Minuten für Musik habe, bleibe ich beim Scrollen durch meine Phonothek selten bei ihnen hängen.
Zum Spätentwickler passte, dass ich bereits 16 war, als ich zum ersten Mal eine öffentliche Disko betrat. Es war die Zeit der sehr bunt bemalten Mädchen mit sehr hochtoupierten Haaren und der Jungs in Schiedsrichterhemden mit schwarzen Lederkrawatten. Berlin war nicht weit weg, im Club liefen „Our Darkness“, „Fade To Grey“ und „Tainted Love“. Und: „Blue Monday“. Der Song bedeutete mir nichts. Neil Tennant von den Pet Shop Boys hat mal von seinem Erweckungsmoment beim Hören des Stückes gesprochen und wie sehr dieser elektronische „Umpta-Umpta, Umpta-Umpta, Umpta-Umpta“ Rhythmus das gewesen sei, was sein Mitstreiter Chris Lowe und er immer hatten machen wollen. Mich ließ der harte, leere elektronische Sound sprichwörtlich kühl. Kein Gefühl. Das unnahbare schöne Mädchen an der Bar, von der du spürst, dass sie eine Nummer zu groß für dich ist.
Die coolen Jungs in meinem Freundeskreis wussten damals schon, dass New Order, die hinter „Blue Monday“ steckten, aus der Asche einer musikalisch deutlich anderen Band entstanden waren. Das machte mich neugierig auf Joy Division, zu denen ich allerdings erst Zugang fand, als die Zeit für den Austausch tief enttäuschter Blicke auf dem Betriebsberufsschulhof gekommen war. Da Traurigsein und Singen für einen grundsätzlich optimistischen Heranwachsenden auf Dauer doch zu anstrengend sind, war es irgendwann dann auch mal gut mit der Depression. Es dauerte zwar noch Jahre, bis sich auf meinen Mixed Tapes fröhliche Songs fanden, aber vielleicht habe ich den verletzungsfreien Abschied von „Unknown Pleasures“, „Floodland“ und „Disintegration“ nicht zuletzt New Order zu verdanken, die sich nach dem traurigen Ende von Joy Division mit den Jahren häuteten und sich in meinen konfusen, aber letztlich doch lebensbejahenden Zeiten als junger Erwachsener in mein musikalisches Herz spielten.
Das Verliebtsein war in vollem Gange, wechselnde Beziehungen im Albumveröffentlichungstakt: Vorfreude, Jubel, Enttäuschung und die nächste bitte. Von der einen großen Liebe keine Spur – und doch kamen sie beide am Ende dann noch zusammen. Als die mit den grünen Augen mich verließ, gab sie mir zum Abschied die Compilation „Heart And Soul“ in die Hand, die sie sich gekauft hatte, weil wir an zwei verschiedenen Orten lebten. „Es sei die Deine“, sagte sie und brach mir das Herz.
Es gibt natürlich kaum bessere Musik, um sich in seinem Unglück zu suhlen als Joy Division, aber als ich den Kopf so langsam aus der Schlinge bekam, wurde es allmählich hell. Ich behaupte mal, dass dies 1994 der Auslöser dafür war, dass ich etwas zurückspulte und mich an New Order erinnerte. Ich hatte die frühen Platten gehört aber Schwierigkeiten mit der Metamorphose von Joy Divisions Düsterkeit zur Disko-Mucke ihrer Nachfolgeband. Als 1987 „Substance“ erschien, stand mir der Sinn einfach noch nicht nach Tanzen. Die richtige Band zur falschen Zeit. Allerdings waren mir der Elektroniksound, Peter Hooks Bass und der eher dünne und vielleicht gerade deshalb unverwechselbare Gesang von Bernard Sumner in Erinnerung geblieben. Und ich wurde langsam erwachsen – Disko ging und selbst Lachen auf der Tanzfläche war erlaubt.
Mit siebenjähriger Verspätung hörte ich mir „Substance“ schön und irgendwann blieb ich immer wieder beim letzten Song der ersten CD hängen. Wie bei einer Menge anderer Bands, deren größte Erfolge selten auch meine Lieblingssongs sind, ging und geht es mir mit New Order. „Blue Monday“ finde ich mittlerweile OK, aber sollte ich noch einmal in die Lage geraten, mir bei einem DJ einen Song zu wünschen, dann wird dies derselbe sein wie jener, auf den ich mich schon Wochen vor den raren Konzerten der Band freue: „True Faith“.
Es ist mein Lied, es ist perfekt. Es ist Pop und Indie. Es ist tanzbar, ohne Funk oder R&B zu sein. Es ist ein Song, der die Dunkelheit Joy Divisions noch in sich trägt, aber auch die Aussicht auf bessere Zeiten. Es ist das gelobte England fern hinter dem Eisernen Vorhang, es ist Manchester in den Achtzigern. Es hatte die besten, fettesten Synthesizer, als ich noch Synthesizern hinterhergestiegen bin. Es hat die Hook Line. (Auch wenn der Peter leider Fan des völlig falschen Fußballvereins ist!) Es hat ein Video, das ein Kunstwerk seiner Zeit war. Es hat eines der schönsten Plattencover aller Zeiten. Es hat die beste aller New Order B-Seiten. Es hat einen Text, der mit Drogen zu tun hat, aber nicht von ihnen handelt. Die erste Halbstrophe reicht mir, um mich an miesen Tagen von übler Laune zu befreien:
I feel so extraordinary,
Something’s got a hold on me
I get this feeling I’m in motion
A sudden sense of liberty
Und wie oft habe ich in Momenten, in denen lang gehegte Hoffnungen in Erfüllung gingen oder große Anstrengungen belohnt wurden, unwillkürlich lächelnd
I used to think that the day would never come
I’d see delight in the shade of the morning sun
vor mich hingesummt.
Es macht mich sentimental, aber es hängt mir noch immer nicht zum Halse raus. Es erinnert mich. Es ist mit mir älter geworden und ich liebe seine Falten. Es ist meins. Es ist Liebe. Die eine – für immer. True Faith.
P.S.: Dieser Text erschien zuerst im Buch „Various Artists – Ich Liebe Musik Vol. 2“ (2020, Windlust Verlag) und wurde von Axel Mewes über den Song „True Faith“ von New Order geschrieben.