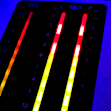Von Onkel Rosebud / Jörg Hiecke
Ich liebe Listen. Top-Fives für alles Mögliche kann ich bei jeder Gelegenheit raushauen. Und da mir das nicht reicht, pflege ich ständig die Top 5+1 für das, was mir im Leben am wichtigsten ist. Auf den ersten 4 Plätzen rangieren seit Beginn meiner Zeitrechnung dieselben drei Personen und ein Ding. Platz 5 und 5+1 unterliegen einer gewissen Fluktuation. Neben Eibauer Bier (Neunziger), Island (2008), der grandiosen Fernsehserie „Justified“ (6 Staffeln, 2010 bis 2015), der schönsten Stadt der Welt (Edinburgh, 1993 bis heute), einem boxenden, kommunistischen Känguru (2013) oder dem Komiker Jan Böhmermann (2014 bis heute) hielt da längere Zeit die Band Tocotronic (oder wie ich sie eigentlich nannte „Trockentonic“) die Stellung.
Bier trinke ich mittlerweile nur noch zur Doppelkopfrunde. Island ist mir zu trendy, ABER irgendwann fahre ich da noch mal hin, damit meine Liebste ihren Tinnitus wieder abgibt. „Justified“ ist ein äußerst rundes Bergarbeiterdrama. U.S. Marshal Raylan Givens (Timothy Olyphant), der als moderner Cowboy für Recht und Ordnung sorgt und damit gleichzeitig manche Grenzen überschreitet, muss sich mit seinem Schulhof-Antagonisten Boyd Crowder (Walton „Schauspielgott“ Goggings) bekämpfen und ab und zu zusammentun, gegen noch fiesere Typen. Das Känguru hat nachhaltig Eingang in das Leben unserer Familie gefunden. In bestimmten Situationen hilft immer ein Känguru-Zitat und alle wissen, was gemeint ist. Jan Böhmermann: Denn, wenn er lacht, gehen drei Sonnen auf. Und da bin ich jetzt beim eigentlichen Thema meines Aufsatzes.
Die drei, dann vier „Jungs“ aus Hamburg hielten meine Bastion der inkarnierten Zuneigung bis zum 01. Mai 2015. Da erschien das „Rote Album“. Ich war einer der größten Trockentonic-Fans auf der Welt, wenn nicht sogar deren Demiurg (Demijörg?), und dieser Text handelt davon, warum ich das nicht mehr bin, wieso man dadurch von heute auf morgen ein Bekleidungsproblem bekommt und warum das alles egal ist und vor allem „ABER“.
1995, an einem Dienstag im Bärenzwinger: Ich war der Resident-DJ. Die Hütte wie immer brechend voll. Ich weiß nicht mehr, wie der Typ hieß. Er war eigentlich immer da und er fragte mich, wie um den Grund seines Immer-da-Seins zu rechtfertigen: „Hast Du Tocotronic? Kannst Du das spielen?“ Ich hatte noch nie davon gehört. (Mir ist das damals häufig passiert, auch in anderen Locations: „Hast Du Chemical Brothers?“ Sagte man dann „Nee“, dann gingen die woanders hin. ABER lügen hätte keinen Sinn gehabt, weil die dann den ganzen Abend auf ihr Lied gewartet hätten.) Als DJ im damals – vor allem wegen der Bierpreise – angesagtesten Club der Stadt kann man natürlich nicht zugeben, dass man keine Ahnung hat, wer/was Tocotronic ist. Also faselte ich was von „Hmm, mal sehen, uuh überbewertes …“ Daraufhin gab er mir eine CD, die Maxi von „Ich möchte Teil einer Jugendbewegung sein“. Und ich habe daraufhin etwas gemacht, was ich als DJ nie wieder gemacht habe und was ich nicht weiterempfehlen kann: Ich habe ein Lied öffentlich aufgeführt, was ich selbst vorher noch nie gehört hatte.
Es sei noch angemerkt, dass als DJ vor allem eines wichtig ist: die Dramaturgie. Bis spätestens 22 Uhr musst du die Tanzfläche voll haben, besser noch eher. Das geht nur über die Mädels. Kriegst Du die Mädels, kommen die Jungens von ganz allein. Eingängige Melodien helfen da. Sparten und Nischen werden später bedient, wenn der Zeitpunkt des Abends gekommen ist, wo es egal ABER ist, was läuft. Und Experimente machst du am besten im Vorprogramm oder hinten raus. So bog ich also aus der damals obligatorischen Britpop-Runde in „Ich möchte Teil einer Jugendbewegung sein“ ein. Jugendbewegung hörte sich gut an. War ich ja quasi auch. Bin ich bis heute. Das Ergebnis war verheerend. Die DJ-Höchststrafe ist, wenn alle tanzen und dann von jetzt auf gleich plötzlich keiner mehr. In dem Fall hat einer getanzt. Und das war nicht mal der Typ mit der CD (sondern einer meiner bis heute besten Freunde). Ich war bestürzt, ABER der Erste, der im Bärenzwinger Tocotronic gespielt hat. Und als DJ geht es neben Dramaturgie natürlich auch um Ruhm.
Ruhm für einen DJ ist, wenn sich völlig unbekannte Partyteilnehmer für die Musik bedanken, bevor sie nach Hause gehen. Ruhm ist auch, wenn sich Gäste nach Band und Titel eines Liedes erkundigen, was der DJ selbst gut findet oder selten spielt. Ruhm ist mir als Schallplattenunterhalter natürlich einige Male passiert, sonst würde ich das bis heute nicht machen. Fragt mich nach der Geschichte zu dem „Video mit dem Lied, wo das Mädchen die Straße runtergeht“.
Mein persönlicher Durchbruch mit Trockentonic kam nicht mit dem ersten Album „Digital ist besser“, auf dem die „Jugendbewegung“ drauf ist, sondern eigentlich mit der EP „Nach der verlorenen Zeit“, auf dem der mir sowas von aus dem Herzen sprechende Gassenhauer „Michael Ende, Du hast mein Leben zerstört“ drauf ist. Und natürlich der einzige Song, zu dem Bassist Jan Müller singt und der jahrelang in mein DJ-Standardrepertoire, quasi den Blueroom-Kanon, der letzten fünf Lieder auf einer Party eingebaut wurde, „Es ist einfach Rockmusik“. Das führte dann also dazu, dass ich mir immer seit „Wir kommen um uns zu beschweren“ aus dem Jahre 1996 das neue Trockentonic-Album am Tag, als es rauskam, zugelegt habe.
Das ging jahrelang gut. Kaufen, Auspacken, Zelebrieren. 1997 habe ich sogar eine Record-Release-Party zu „Es ist egal, ABER“, dem meiner bescheidenen Meinung nach größtem Wurf der Band, veranstaltet. Auf dieser Platte ist auch mein Lieblingslied der Band, „Ein Abend im Rotary Club“. Ich habe mir immer vorgestellt, dass dieses Lied dasjenige ist, dass am Grab zu meiner Beerdigung gespielt werden soll. „Noch vor kurzem hätte ich nicht im Traum daran gedacht, dieser Veranstaltung hier beizuwohnen …“ …und alle heulen dazu. Auch hatte ich mir vorgenommen, „alles drauf verwenden zu müssen, die Vorgänge genau zu verstehen“. Der Song taucht übrigens auch in dem ziemlich verschrobenen Film „Am Strand von Trouville“ (mit dem sagenhaften Boris Aljinovic und der Ikone Lars Rudolph) auf. Jahrelang habe ich dieses Album immer nur einmal im Jahr, an meinem Geburtstag, gehört. Dazu ein bisschen die Luftgitarre bedient, die „Zeitverflugsgeschwindigkeit“ verdammt und still geweint. Mittlerweile kann ich es nicht mehr hören. Es wurde mir zu emotional.
Heute denke ich, was für ein egozentrischer Schwachsinn das alles ist. Narzissmus auf höchstem Niveau. ABER, das muss man sich erst einmal leisten können und Trockentonic habe ich deshalb sehr, sehr lange Zeit quasi vergöttert. Ich war auf 14 Konzerten insgesamt. Ich trug ausschließlich T-Shirts der Band. Diese Verweigerungshaltung, die Naivität, dieses Verwirrung-Stiften, die schief geschrammelten Gitarren und Parolen von bekennenden Dilettanten – genau mein Ding. Und ich denke insgeheim, dass diese Verherrlichung von Dirk, Jan und Arne (sowie später Rick) auch wichtig war, der zu werden, der ich geworden bin.
1999 markiert einen Wendepunkt in meinem Leben. Da ist nicht nur der 1. Teil dieses Sammelbandes erschienen und ich habe Uta, die Liebe meines Lebens, kennengelernt; nein, Trockentonic veröffentlichten „K.O.O.K.“ Die erste Single der Platte war „Let there be Rock“ und mir kamen zum ersten Mal Zweifel bezüglich meiner uneingeschränkten Anbetung. Das eingebaute Gitarrenriff von AC/DC fand ich albern. ABER da waren ja noch „Jackpot“, „Tag ohne Schatten“ und „Rock Pop in Concert“. Also nur ein Ausrutscher?
Seitdem entziehen sich Tocotronic, wie ich sie ab dann wieder nannte, erfolgreich meiner Erwartungshaltung und die Abkehr von meinen Idolen kann ich anthologisch an die fünf Phasen des Sterbens nach Elisabeth Kübler-Ross anlehnen: 1. Nicht-Wahrhaben-Wollen, 2. Zorn, 3. Verhandeln, 4. Depressionen und 5. Zustimmung.
Phase 1, Jahr 2002, „Das Weiße Album“: Nach Frau Kübler-Ross ist es so, dass wenn Patienten eine schlimme Prognose erfahren, reagieren sie mit Schock, Verleugnung, Empfindungslosigkeit und körperlichen Beschwerden. Die schlimme Prognose bestand in der Betagtheit dieses Albums, den schwurbeligen Texten und dem perfekten Bedienen der Instrumente. Aus dem Nichts war der Dilettantismus verschwunden. Das hat mir zwar keine körperlichen Beschwerden bereitet, ABER so ähnlich.
Nächste Haltestelle Phase 2 im Jahr 2005, „Pure Vernunft darf niemals siegen“: Zorn. Nach dem ersten Schock brechen Emotionen wie Aggressionen, Wut, Zorn und Schuldzuweisungen aus. Manchmal treten diese Emotionen auch unterschwellig auf und äußern sich darin, dass man es dem Fan – äh – dem Patienten nicht recht machen kann. Wo war er hin, der ironischen Rock-Aufbruch? Und das uns Dirk Gesangsunterricht genommen hat, hätte ich nicht gebraucht. Außerdem hat er sich leider von seiner Zweitband Phantom/Ghost inspirieren lassen, wo die Liebe gegen das H.P. Lovecraft’sche Böse triumphiert.
2007 „Kapitulation“: Phase 3: Verhandeln. Der Fan beginnt mit dem Schicksal zu verhandeln. Er erhofft sich durch eine gute Kooperation eine längere Lebensspanne. Trocotonic wirken angestrengt bemüht, weder bemüht noch angestrengt rüberzukommen, und sind dabei musikalisch recht überraschungsarm.
2010 „Schall & Wahn“: Phase 4: Depression. Hat der Betroffene realisiert, dass er sterben wird, kann dies mit Depressionen, Ängsten und Trauer einhergehen. Er betrauert die Verluste, die er durch die Erkrankung erleiden muss: Verlust körperlicher Integrität, Verlust persönlicher und beruflicher Chancen, Verlust von nicht Nachholbarem und Wünschen, die er sich in gesunden Tagen nicht erfüllt hat. „Und der erste Widerwille war bald dem Gefühl gewichen, dass sich der Abend lohnen könnte, es gab Wissenswertes zu berichten.“
Letzte Phase, 2013 „Wie wir leben wollen“: Zustimmung. In der Phase der Zustimmung hat der Betroffene sein Schicksal angenommen und es tritt ein ruhiger, fast gefühlloser Zustand ein. Der Gesprächsbedarf nimmt ab, der Blick ist nach innen gerichtet und das Verlangen, Besuch zu bekommen nimmt ab. „Man aß und trank und unterhielt sich. Die Wertschätzung war gegenseitig. Und es herrschte ein Vertrauen. Es war mir fast ein bisschen unheimlich.“
Die endgültige Jochen-Distelmeyerisierung meiner ehemaligen Lieblingsband, deren Namen laut zu sagen mir heute sogar ein bisschen schwerfällt, fand für mich 2015 mit dem „Roten Album“ statt. (Für alle, die nicht wissen, wer Jochen Distelmeyer ist: Er und seine Band „Blumfeld“ waren mal auf Augenhöhe mit Gott – naja dem Indie-Gott zumindest. Anfang der Neunziger gehörten die beiden Schallplatten „Ich-Maschine“ (1992) und „L’état et moi“ (1994) in jede Schultüte und bis 2006 ging’s nur noch bergab bis zum ZDF-Fernsehgarten-Album „Verbotene Früchte“). „Auch habe ich die meisten Menschen, selten so wie diesen Abend gesehen, ich werde alles drauf verwenden müssen, die Vorgänge genau zu verstehen.“
Ich will wirklich nicht darauf eingehen, wieso. ABER, da saß ich nun, im Frühsommer des Jahres 2015, vor meinem Kleiderschrank und musste feststellen, dass von den sechs Oberteilen im T-Shirt-Stapel, die nur ernsthaft in Frage kommen, sich damit in der Öffentlichkeit blicken zu lassen, mehr als die Hälfte den vormals verehrten Schriftzug trugen. Ich verrate nicht, wie viele es wirklich waren. Fakt ist, bei einer plötzlichen Abkehr von Idolen, kann man froh sein, dass die nicht auch noch Hosen produzieren ließen. Also bestellte ich „Winter is coming“.
Weil, das gilt immer!
P.S.: Dieser Text erschien zuerst im Buch „Various Artists – Ich Liebe Musik Vol. 2“ (2020, Windlust Verlag) und wurde von Jörg Hiecke über den Song „Ein Abend im Rotary Club“ von Tocotronic geschrieben.