
Den einen bremst Corona, den anderen beflügelt es, und so umtriebig wie während der Pandemie war das Moskauer Label addicted/no name wohl noch nie. Neue Alben, Singles und EPs von unter anderem The Grand Astoria, IWKC, Pressor, Pree Tone, The Legendary Flower Punk und Резина sind darunter, die Musik deckt Spielarten ab wie brutalen Jazz, Doom, Spacerock, Noiserock, Progrock, Artrock, Stoner und Psychedelic. Unter anderem!

Heavenscape – Some Sort Of Mental Disorder
Das St. Petersburger Trio bezeichnet seinen Sludge Metal selbst als „regressiv”, weil es ihn so vermeintlich traditionell spielt, doch darf man dazu freundlich kopfschüttelnd feststellen, dass Heavenscape viel zu viele nichtsludgige Elemente in ihr Debüt einfließen lassen. Korrekterweise, denn herkömmlichen Sludge gibt’s ja schon zur Genüge, warum also nicht das Tempo mal reichlich anziehen, die Stimme nach Death Metal rauh grunzend klingen lassen (wenn sie nicht zwischendurch sogar glasklar Oneliner skandiert), knappe Melodien und ausufernde Gitarrensoli einbauen – dem dröhnenden Fuzz des Trios stehen all diese Elemente gut, „Some Sort Of Mental Disorder“ erweckt nicht den Eindruck eines Debüts.
Fünf der sechs Tracks sind zwischen sechs und knapp acht Minuten lang, das sechste Stück nur zwei, und Heavenscape füllen diese Zeit nicht einfach mit sich schleppend wiederholenden Passagen, sondern mit schweren Riffs, atmosphärischen Einschüben, Tempowechseln und unerwarteten Breaks. Eine mentale Störung lösen sie damit auch nicht aus, jedenfalls nicht bei Hörern mit offenen Ohren; womöglich ist das Album vielmehr dazu in der Lage, solche Störungen zu beheben.
Das Trio besteht aus Bassistin Polina Shmurygina, Schlagzeuger Dmitry Fytov sowie Sänger und Gitarrist Egor Tryapitsyn, und diese drei spielen so fett, dass sie nach mehr Musikern klingen. Im Einzelfall stimmt das auch, „Lovesick“ etwa verleiht eine Sängerin namens anytown einen Hauch von Nightwish, nur in gut, und dem Rauswerfer mit dem subversiven Titel „Deconstructing The State“ steht Ekaterina „Kate“ Yantser mit ihrem Piano zur Seite. Außer „regressiv“ ist übrigens „kalt“ noch eine Selbstbeschreibung von Heavenscape, aber auch das stimmt nicht so ganz, dafür sind die Riffs zu voluminös.

IWKC & WZM – Evil Cosmonaut
Nicht als Split-EP, sondern als gemeinsam eingespielte Tracks veröffentlichen I Will Kill Chita aus Moskau und Wille Zur Macht aus Zweibrücken „Evil Cosmonaut“. Nicht die erste, sondern die mindestens dritte gemeinsame Arbeit nach „Two Bridges“ 2017 und „Logbook Of The Ark“ 2019. WZM, nach dem Nietzsche-Zitat benannt, halten sich recht geheimnisvoll, beschreiben ihre Musik als jazzinfizierten Experimentalrock, und wenn man den – nun – Artrock von I Will Kill Chita danebenhält, kann man sich nicht ausmalen, wie „Evil Cosmonaut“ letztlich klingt: nämlich nach extrem schleppenden Drones, nach dem leeren Kosmos, so böse, wie der Titel es suggeriert, heavy, episch, dunkel.
Laut Info sollte der Track nur fünf Minuten lang werden, aber eine während der Aufnahmen zu „Logbook Of The Ark“ fehlende Acht-String-Gitarre zwang die insgesamt sechs Musiker zu einem Standortwechsel, und weil der „crap“ richtig heavy werden sollte, uferte der Song danach auf die doppelte Spielzeit aus. Das zweite Stück, „Meine Seele selber ist diese Flamme“, wiederum mit Nietzsche-Bezug, entstand abschließend als Befreiungsschlag, mit heavy Riffs, ordentlich Tempo, synthetischen Noises und roher Gewalt, überzeugend genug für das staunende Bandprojekt, um unbehandelt diese EP abzurunden.
Von IWKC dabei sind Nikita Samarin, Artem Litvakovskiy, Andrew Silin und Nick Samarin, von WZM Nicolas „Nicholas“ Perrault, der Anfang 2020 sein Solodebüt „Shadows Cast At Dawn“ veröffentlichte, und Dominik Franz Philipp Klein. Es muss an der Mischung liegen, dass „Evil Cosmonaut“ so völlig anders klingt als die einzelnen Teile.

DEEBBBB – Episode 2
Und nochmal IWKC, hier in ihrer Inkarnation als Evil Bear Boris, und noch einmal ein Zusammenschluss zweier Bands, denn außer EBB sind noch Detieti Teil dieses Improvisationskollektivs, das voll ausgeschrieben nun „DetiEti Evil Bear Boris Big Band“ heißt und dieses Mal freejazzig improvisiert, weil nun als dritte Komponente noch das Speedball Trio an Bord ist, und das ist ein Punkjazzprojekt, siehe weiter unten. Und wenn man „Episode II“ hört, mag man nicht glauben, dass diese vier überlangen Tracks frei improvisiert sind, und dann noch von zehn Musikern: Nikita Samarin (Schlagzeug), Victor Tikhonov (Schlagzeug und Percussion), Sergey Bolotin (Schlagzeug), Nick Samarin (Bass), Mikhail Ivanov (Bass), Hassan Mustafin (Bass), Andrew Silin (Keyboards), Peter Bolotov (Keyboards), Alexander Kosarenko (Gitarre), Anton Ponomarev (Saxophon) – also je drei Schlagzeugern und Bassisten, zwei Keyboardern sowie je einem Saxophonisten und Gitarristen. Kein Gesang!
„Episode 2.1“ groovt sich knapp 20 Minuten lang in einen spacigen Discotrack, mit sphärischem Keyboard, geslapptem Funk-Bass und galoppierenden Drums. „Episode 2.2“ ist in zwei bis drei Versionen enthalten, „2.2“, „2.2a“ und „2.2b“, alle ungefähr gleich lang, nämlich einundzwanzigeinhalb Minuten. Hier treiben Bässe und Schlagzeuge das Tempo voran, kreieren Keyboarder Loops, auf denen Saxophon und Gitarre improvisieren und solieren. Das Ganze ergibt im weitesten Sinne einen jazzigen, krautigen Grooverock mit gelegentlich dem Lärm nahen Ausflügen ins Spacige. Die Rhythmen wechseln, auch einem Offbeat ist das Projekt nicht abgeneigt. Wie das Projekt, braucht man aber auch als Hörer einiges Sitzfleisch, um die anderthalb Stunden konzentriert durchzuhören, denn wie auch die Musiker neigt man auch als Rezipient dazu, sich alsbald in der ausufernden Musik zu verlieren. Und doch holt einen das Kollektiv fortwährend aus der Trance, denn man kommt nicht umhin, immerfort festzustellen, dass man es mit begnadeten Musikern zu tun hat, die improvisiert mehr Großartiges auf die Beine stellen als andere mit komponierter Musik, mit weit weniger nervtötendem Gegniedel und weniger atonal, als es zu befürchten steht, auch wenn gegen Ende schon mal die Gäule mit ihnen druchgehen, denn dafür haben die Musiker viel zu viele gute Ideen. Obwohl, den finalen Track „2.2b“ hätten sie vielleicht weglassen können, aber als Dokument der Zusammenarbeit ist er aufschlussreich.
„Episode 1“ erschien fünf Jahre zuvor, mit nur acht Musikern und nur zwei Tracks mit zusammen 30 Minuten Spielzeit, also einem Drittel dessen, was DEEBBBB nun mit „Episode 2“ zusammentrugen. Und in diesen anderthalb Stunden geben sie alles, nur keine Ruhe.

Резина – 1619
Ein bemerkenswertes Album: Резина (Resina, international: Rezina, „Kautschuk“, „Gummi“) aus Moskau laden sich neun Singende ins Studio ein, um für jeden ihrer Tracks des Albums „1619“ eine andere Stimme featuren zu können. Diese Stücke sind episch lange psychedelische, eher dem Indie- oder Postrock als dem Hardcore nahegelegene Songs, die nicht der klassischen Popsongformel folgen und zudem eher mit Harmonien als mit Melodien trumpfen. Die meisten dieser Stücke sind zudem auf Russisch vorgetragen, was dem Sound eine für westliche Ohren exotische Komponente verleiht und einfach perfekt in die Musik passt.
In dieser Musik nun steckt Wucht, aber nicht zwingend Heavyness, mehr Noisecore als Alternative Rock, mehr Les Hommes Qui Wear Espandrillos als Placebo, und dabei sind Резина so episch, dass man sich streckenweise an die experimentelleren Alben von Neil Young aus den Neunzigern erinnert fühlt, nur eben wuchtiger, harscher, schleppender. Um Groove geht es der Band nicht, damit ist die Musik dem New Yorker No Wave oder den frühen The Wedding Present näher als etwa Refused. Und sie bauen zahllose Elemente ein, die den Fluss unterbrechen und die Kompositionen mit einer überraschenden Spannung aufladen.
Das längste und beste Stück dieses ohnehin großartigen Albums befindet sich an sechster Stelle: „Ближе“ beginnt mit einem ewigen Intro, das strukturell leicht an Russische Folklore erinnert, und steigert sich zu einem wunderschön flirrenden Postrocksong, der zusätzlich gewinnt, sobald die Stimme einsetzt: Mit der früheren Flёur-Sängerin Елена Войнаровская, außerdem bei Amurekimuri und МРФ, tritt nämlich erstmals auf „1619“ eine Frau ans Mikro und spricht und singt ihren Text ein. Fast zehn Minuten überwältigende Schönheit, die sich sogar zum Ende hin noch zu steigern weiß. Unglaublich gut. Das folgende Stück muss dann zwangsweise in den Swans-artigen Noise driften, alles andere wäre ein Rückschritt. Mit Мария Любичева alias Masha alias Nosuha von Огни Святого Эльма und Барто ist vorletztens auf „Побег“ einmal mehr eine Frau zu hören.
Sechs Musiker teilen sich den Bandnamen, nicht alle sind auf allen neun Stücken dabei: Резина sind die Gitarristen Илья Зинин und Андрей Климов, die Bassisten Дмитрий Сироткин und Антон Образина sowie die Schlagzeuger Дмитрий Дроздов und Максим Бревнов, also eigentlich eine Instrumentalband, die sich hier für den Gesang bei den Punk-Superstars Russlands bedient, wie es ein Rezensent bemerkt, wobei die Wahrheit noch viel krasser ist, denn die Hauptbands der Gäste decken ein Spektrum zwischen so entlegenen Polen wie ukrainischer Folklore und Electroclash ab; neben den Genannten sind dies Олег Ягодин von Курара, Илья Черепко-Самохвалов von Кассиопея und Петля Пристрастия, Ron Gallipoli alias Samuel Bradford von Sharpie Crows, Андрей Машнин von Машнинбэнд, Алексей Никонов von Штыкнож und П.Т.В.П., Александр Александров alias DrOff von Nikto und Чичерина sowie Ян Никитин von Театр яда. Sie alle machen „1619“ zu einem Anwärter für einen Topplatz in der Jahresbestenliste 2020.

Crust – … And A Dirge Becomes An Anthem
Der Bandname gibt schon grob die Richtung vor, doch die ist gar nicht so eindeutig, wie man danach glauben mag: Crust beschränken sich nicht darauf, klischeehaft nur ein Genre zu bedienen, sondern bedienen sich bei sehr vielen, die so gut zusammenpassen, dass dabei mit „… And A Dirge Becomes An Anthem“ ein ausgesprochen grandioses Album entsteht. Black Metal mag man heraushören, Sludge, Doom, Death Metal. Manchmal flirrt die Gitarre wie beim epischen Post-Black-Metal, die Stimme grunzschreit wie im Death Metal, das Tempo ist so gebremst wie im Doom und die Riffs sind so wuchtig wie beim Sludge. So muss das, weil so jedes dieser Genres eine Aufwertung bekommt, und weil Crust einfach genau wissen, was sie für ihre Melange brauchen und worauf sie verzichten können.
In ihr stürmisches Gebrüll betten Crust eben auch zurückgenommene Akustikgitarrenpassagen ein; „Beneath The Cold Clay“ belegt in nur 1:22 Minuten Spielzeit die Variabilität der Band, die danach nämlich den Sturm wieder losbrechen lässt. So machen Crust also aus dem Klagelied eine Hymne. Und das nur zu dritt: Roman Romanov sitzt am Schlagzeug, Vlad Tatarsky spielt Gitarre und Artur Filenko sind Bass, Akustikgitarre und Gesang zu verdanken. Auch dieses Album klingt also weit fetter, als es diese Besetzung vermuten lässt. Es ist zudem für diese Spielarten der Heaviness enorm abwechslungsreich und scheut auch nicht, Melodien zuzulassen. Das Gemisch ist einfach unschlagbar gut. Und schmeißt den Hörer mit dem beinahe ambientartigen „Space Sabbath“ entspannt zurück in den Alltag.
Nach diversen EPs und dem Debüt „The Promised End“ ist dies das zweite Album von Crust, inzwischen liegt mit „Shallow Grave“ auch noch eine neuere Live-EP vor. Einzig der Bandname ist schwierig, denn den gibt es bereits mehrfach. Nur vermutlich nicht in Nowgorod.

Kamni – Mandala
Cover und Albumtitel führen etwas in die Irre: Bei „Mandala“ handelt es sich nicht um kosmische Entspannungsmusik mit Sphärenklängen, sondern um bekiffte Entspannungsmusik mit heavy psychedelischen Stromgitarren. Камни heißt Steine, und Stoner steckt auch in der Musik der Moskauer: Das Quartett gniedelt sich und den Hörenden in Trance, dass es einem die Drogen erspart. Mit ordentlich Fuzz im Bass, knarzend tiefergestimmten Gitarren, alles verschleppt und verbummelt, weitgreifend, weitschweifend, wabernd, das Wahwah voll durchgetreten, alle Regler auf Anschlag.
Und doch bleibt zwischen den Wänden immer wieder Raum für instrumentale Experimente, fürs Gehenlassen, Treibenlassen, Fallenlassen, wenn sich aus dem Dröhntannenwald eine nebelfreie Lichtung herausschält, wenn die Verzerrer noch nicht zugeschaltet sind und der Schlagzeuger noch am Kühlschrank guckt, was es wohl zu futtern gibt. In der Mitte, in „So Many Toughts (In My Stoned Head)“ [sic!], klingen Kamni dann beinahe nach einem Neunziger-Shoegaze, dem man die Effektgeräte geklaut hat; ein enorm tightes Stück Rockmusik. Die Band hat allgemein einen starken Hang zum Druck – die Songs sind so dicht wie die Köpfe der Musiker – und die erfreuliche Neigung zum Kopfnickerrhythmus.
Insgesamt kann man diese Art von Stoner beinahe als klassisch betrachten – wäre da nicht der Gesang: Die spärlichen Texte sind nämlich allesamt auf Russisch gehalten, was auf jeden Fall für Aufhorchen sorgt, weil man damit außerhalb Russlands und in den Genre eher nicht rechnet.
„Mandala“ ist das dritte Album der Band in zehn Jahren, dazu kommen einige EPs und Splits. Von Anfang an dabei ist nur Gitarrist und Sänger Paul. Später dazu kamen Bassist Artem Bely, auch bekannt von Tsygun und Phantomass, sowie Gitarristin Jenya und Schlagzeuger Leo.

Speedball Trio – Speedball Trio
Als „New Wave Of Heavy Jazz“ bezeichnet sich das Speedball Trio aus Moskau, und so kann man es auch bezeichnen, wenn man eine sehr freie Variante von Jazz macht, mit wild um sich schlagendem Saxophon und einem Rhythmusrumpf, der irgendwo zwischen Punk und Postcore oder so etwas zu Hause ist. Denkt man sich das Saxophon weg, hat man einen dicht gespielten Wasauchimmercore, mit einem Einschlag der frühen Dischord-Veröffentlichungen und einem Hauch Les Claypool, doch das Saxophon dazwischen verwischt diesen Eindruck, verwirrt den Hörer, denn es trötet, flirrt, stöhnt, ächzt, seufzt, insistiert, ringt um Aufmerksamkeit und torpediert das zögerliche Empfinden, es mit geradliniger Rockmusik zu tun zu haben.
Dabei ist die Musik gar nicht so ungerade, man muss nur genau hinhören und versuchen, das Saxophon als losgelöstes Wesen zu akzeptieren, das mit Bass und Schlagzeug auf seine Weise herumtollt, befreit von den Zwängen, dabei etwa Popmusik entstehen lassen zu müssen. Diese Musik ist nicht eben schön, das will sie auch gar nicht sein. Sie will herausfordern, und das tut sie, fürwahr. Wie schöne Musik geht, das wissen die drei Musiker sehr wohl, und zur Entspannung schmuggeln sie immer mal gefällige Passagen in die Setlist ein, nur um sie dann umso rücksichtsloser ins Rabiate, Unwirsche, Ruppige, Räudige dringen zu lassen. Zum Abschluss liefern die drei den „Paindance“, und der Titel trifft es: Man kann dazu bestens abtanzen, aber das Saxophon verursacht einigen Schmerz dabei.
Erst vor zwei Jahren fand dieses Trio zusammen, allesamt Musiker, die andernorts bereits für Furore sorgten: Anton Ponomarev spielt bei Brom, dem Ponomarev-Obrazeena Massacre, Solvychegodsk und Sanscreed Kanon, Sergey Bolotin bei Usssy und Hassan Mustafin bei Solvychegodsk. Und alle zusammen kennt man bereits von DEEBBBB, siehe oben.

The Grand Astoria – From The Great Beyond
Endlich wieder ein neues Album von The Grand Astoria! Okay, eher eine EP. Fünf Jahre nach „The Mighty Few”, und, na ja, den experimentellen Zwischenob- und –projekten „The Grand Astoria Meets The Finest Moscow Sound Explorers“, „Solo Instrument Concepts“, diversen Live-Bootlegs und EPs stellen die St. Petersburger mit „From The Great Beyond“ den nächsten Crossovermonolithen ins All. Crossover aber nicht zwischen Metal und Hip Hop, sondern auf Basis des spacigen Stonerrocks mit Progrock, Avantgarde, Folklore, Gospel und was das Herz sich sonst noch so ausmalen mag. The Grand Astoria treten ihre Reise durch diese Genres auf einem Fluss an, der sie fließend verbindet und nicht wie auf einem Ausflugsdampfer schlicht an Etappen vorbeischippert. Wobei dieser Fluss ein reißender ist, das Tempo ist irrwitzig und damit auch die Art und Weise, wie die Band was worauf folgen lässt, besser: was miteinander verbindet.
Man kann nur staunen. Diese Band hat alles drauf, was man sich vorstellen kann, und sie hat darüber hinaus auch noch Sachen drauf, die man sich nicht vorstellen kann. Da tanzen Flöten und Banjos um einen fröhlichen Artrocksong, da riffen sich Erinnerungen an Monster Magnet aus den Boxen, da komponiert die Band herum wie die Beach Boys im Classic-Rock-Radio. Staunen, tanzen, kopfnicken und glücklichsein.
Das Personal ist so opulent wie die Musik: Bandchef Kamille Sharapodinov spielt diverse Gitarren, singt und steuert Percussions bei, Danila Danilov singt und spielt Keyboards und Percussions, Alexander Vorontsov spielt Bass, Konstantin Smirnov Schlagzeug. Als Gäste dabei sind Keyoarder Gleb Kolyadin, die Gitarristen Igor Suvorov und Kirill Ildyukov, Flötist Denis Kirillov und Banjospieler Boris Shulman. So komplex, wie die Mucke ist, die diese Bande ersinnt, nimmt es nicht Wunder, dass sie etwas länger braucht, um etwas Neues zu kredenzen. Eine begeisternde EP.

The Legendary Flower Punk – Beatroot 2020
Was macht man, wenn eine nach monatelanger Arbeit geplante Tour wegen einer Pandemie ausfällt? The Legendary Flower Punk spielen die Konzerte einfach für sich selbst, improvisieren für jeden der 16 Termine vor sich hin, veröffentlichen jedes der Konzerte zum Download, um die Ausgaben refinanzieren zu können, und stellen ein Extrakt der „besten Stellen“ als zweieinhalbstündiges Album unter dem Titel „Beatroot 2020“ bereit.
Wie bei DEEBBBB gilt auch hier: Wenn das alles improvisiert ist, „jammed“, wie die Band schreibt – dann kann man nur vor Ehrfurcht niederknien. Wer so etwas ohne zu komponieren hinbekommt, straft sämtliche unbegabten Komponisten ab. Natürlich sind einige Strecken dieser Musik experimentell, doch was in den weniger spacigen oder jazzigen Passagen entsteht, steckt viele andere Art-, Fusion-, Funk-, Kraut-, Stoner- und Progrocker in die unterste Schublade. Die Band ist in der Lage, bei einem solchen Tempo eingängige und nachvollziehbare Instrumentals zu generieren, basierend auf Loops, garniert mit Soli und Noises, miteinander in alle Richtungen zu entweichen und auf wundersame Weise wieder zusammenzufinden. Dabei macht es sich die Band nicht mal einfach, indem sie simpelste Strukturen aufgreift oder so etwas, sondern sie verliert sich in Komplexität, als sei dies das Leichteste der Welt, und bleibt dennoch vielfach sehr eingängig. Und atmosphärisch, nicht immer dominiert der Galopp, bisweilen verlieren sich die Musiker auch in kontemplativem Gniedeln, und auch dann gerät die Musik schön.
„White Magick Zen“ etwa findet die anfängliche Hook nach über 20 Minuten Spielzeit ganz unerwartet wieder, „Trance Fusion På Ryska“ ist partiell mit schleppenden bis tanzbaren Beats unterlegt, es erinnert leicht an Kong, nur mit Bläsern. Und „Party Zen“ schwitzt anfangs in synthie- und bläsergetriebenen spacigen Discobeats und driftet dann in einen Spacefunk ab; mit fast 40 Minuten das längste Stück auf dieser Sammlung, übrigens, und vielfältiger und ausgefuchster, als es andernorts ganze Alben sind. Das „Zen“ steckt in sieben der zehn Tracktitel, eine Eigeneinschätzung des Sounds, die wohl eher auf den Zustand der Musiker zutrifft als auf den der Hörer, den die mitreißenden Tracks eher aufrütteln als in Trance versetzen, mit Ausnahmen wie dem treffend betitelten „Every Now And Zen“.
Chef des Ganzen ist wie bei The Grand Astoria Gitarrist und Percussionist Kamille Sharapodinov, im Proberaum bei ihm waren Bassist Mike Lopakov, Keyboarder und Percussionist Denis Antonov, die Saxophonisten Leon Sukhodolsky und Dmitry Vnukov, Keyboarder und Flötist Denis Kirillov, die Schlagzeuger Nick Kunavin und Nick Antonenko sowie der Trompeter Roman Kvachev. So eine diverse Besetzung lässt schon ahnen, wonach eine Band wie The Legendary Flower Punk so klingen mag, und man liegt trotzdem irgendwo daneben. Unklar ist nur, ob die Konzerte der Tour genau so geklungen hätten; ein Erlebnis wäre eine Show dieser Band nach dieser Album-Erfahrung allemal.

Dusky Dive – Sky
Eine im Studio live eingespielte Single von sieben Minuten Länge veröffentlichen Dusky Dive aus Moskau. An diesem Song ist einiges bemerkenswert: Er beginnt als schwerer Bluesrocker, in den Ivan Izmalkin mit seinem Baritonsaxophon einbricht und ihn dazu zwingt, das Tempo anzuziehen. Die Band wirbelt staubtrocken in die Wüste hinein und alsbald hitzegebremst durch diese Wüste hindurch, dazu schreit sich Sänger und Bassist Aleksey Stanchinskiy aufgebracht durch seine Zigarren- und Whiskysammlung. Und plötzlich setzt ein Offbeat ein und das Stück gerät zum wütenden Ska-Rock.
„Sky“ erweckt den Eindruck, Das Quartett hätte einen Haufen Songskizzen angefertigt, und anstatt daraus ein womöglich langweiliges Album zu strecken, die besten Passagen kurzerhand in einen kompakten Song gepackt. Der hat naturbedingt keine Längen, und auch wenn die Band – neben den Genannten noch Gitarrist Sergey Plishka und Schlagzeuger Grigory Perelman – die Genres so überraschend wechselt, passt doch alles in ein Soundbild.

Pressor – I Want You (She’s So Heavy)
Waren die Beatles nicht schon immer auch bekiffte Psychedelic-Stoner-Doomrocker? Pressor aus Kostroma zumindest sind es, und in deren Hand klingt das Stück wie ein eigenes. Der Britpop ist raus, das Spacige geblieben, besser: verstärkt, das Quartett verlässt die vertrauten Strukturen des Originals auf dieser sechsminütigen Ein-Song-Single recht bald und transferiert sie in einen bedröhnt hallenden Drogenwalzer, nicht so weit weg von Spiritualized, etwas mehr heavy nur.
Eine Besonderheit an der Besetzung ist, dass Sänger und Gitarrist Stas Vasilev auch Keyboards in den Sound einfügt; der wird dadurch an entsprechenden Stellen noch fetter. Den Rest besorgen Gitarrist Anton Khmelevskiy, Bassist Denis Zarutsky und Schlagzeuger Daniil Kornev.
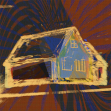
Pree Tone – Brekka
Das ist nicht einfach nur Noiserock, was Pree Tone aus Kiew auf ihrer neuen EP „Brekka“ machen. Wer nachvollziehbaren Lärm machen will, muss wissen, wie man unlärmend musiziert, und dass das Trio das kann, belegt es auf den fünf Stücken immer wieder, in Intros, Zwischenspielen sowie den Harmonien, die den fuzzy Passagen zugrundeliegen. Die Musik ist nicht so atonal wie die New Yorker No Wave der Achtziger, sondern eher so distorted wie der Indierock von Bands wie Sonic Youth, 18th Dye, Girls vs Boys oder Man Or Astro-Man?. Treibend, repetetiv, verspielt, kraftvoll, streckenweise melodiös, und immer so fett, dass man sich wundert, wie nur drei Leute diesen Sound hinbekommen.
Diese drei nennen sich Luna, Vova und Serzh und spielen klassisch Gitarre, Bass, Schlagzeug. Sie scheren sich einen Dreck um Trends und Regeln und spielen ihren Noiserock befreit von Zeit und Ort, ganz bei sich im Hier und Jetzt. Und während sie sich in ihren Tracks verlieren, gewinnt man als Hörer eine halbe Stunde mit grandioser Musik. Diese EP kommt sogar noch besser auf den Punkt als das Vorgängeralbum „Kiddy“ vor zwei Jahren.
Bandcamp
